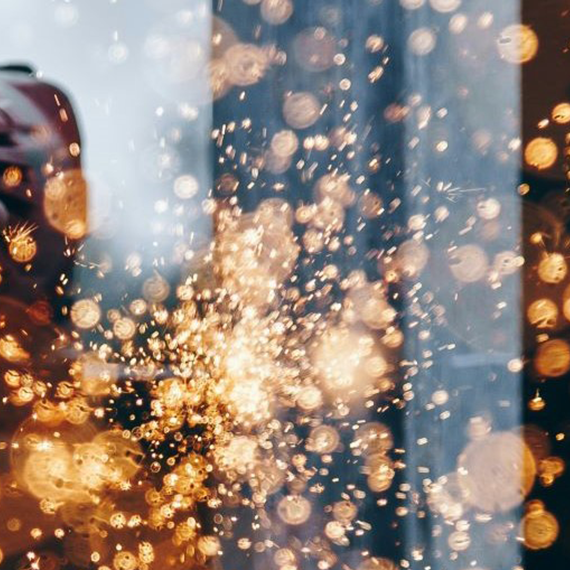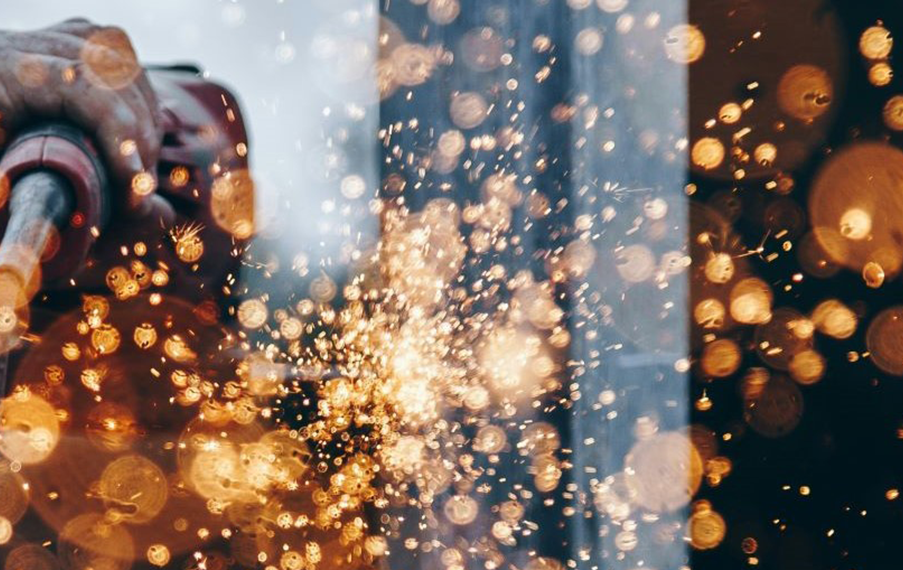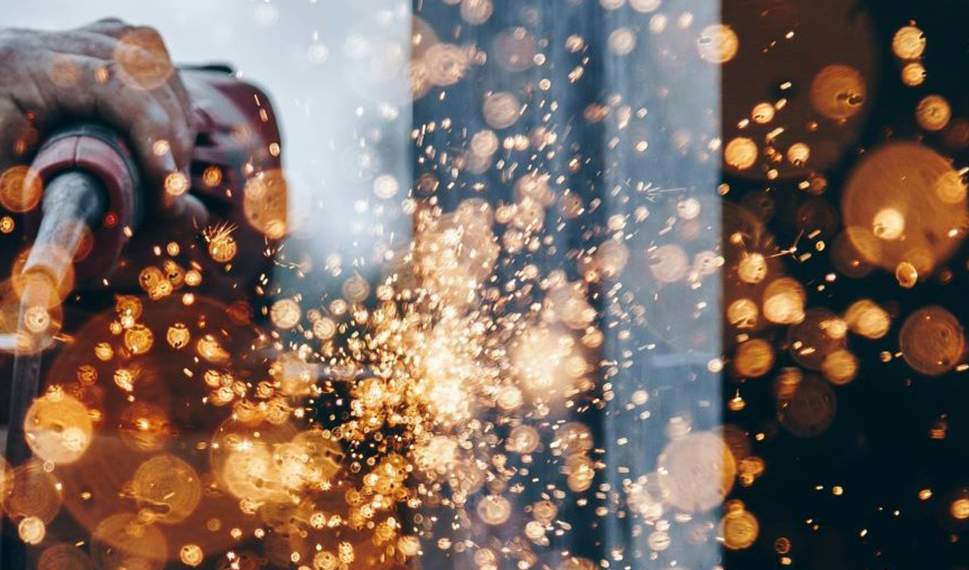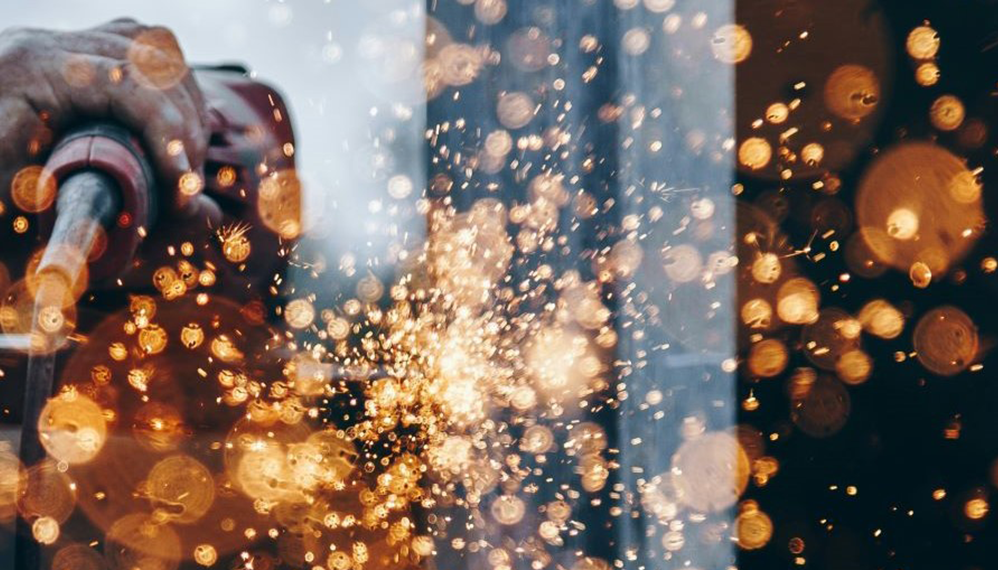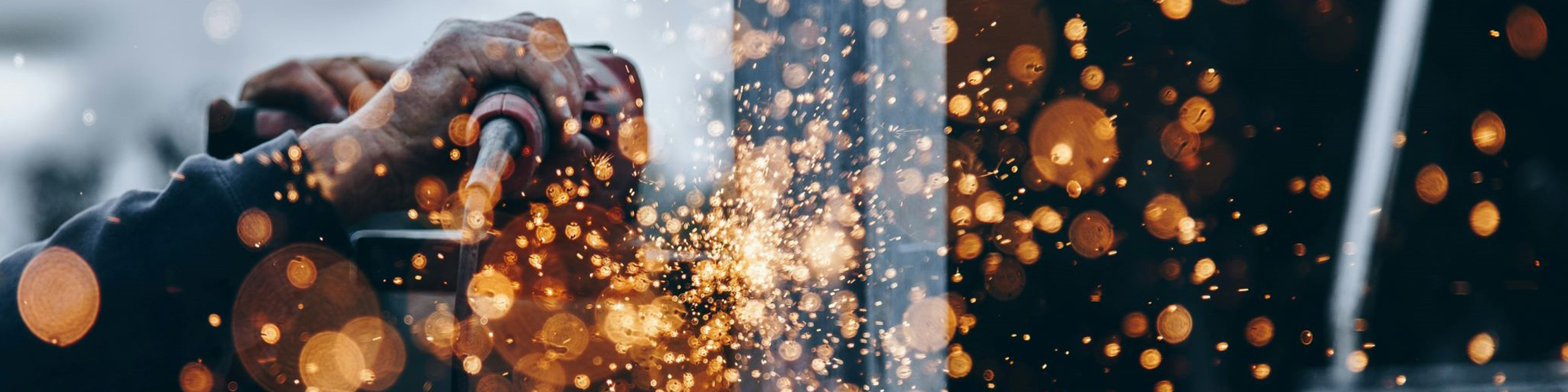20 Jahre Mobbingberatung im Großraum Nürnberg: Bilanz und Ausblick
„Mobbing führt in die Isolation“
Es ist ein Phänomen, das es schon immer gegeben haben dürfte, das aber seit 25 Jahren einen Namen hat: Mobbing. Die katholische und evangelische Kirche in Nürnberg gehörten zu den Pionieren, die vor 20 Jahren mit professioneller Beratungsarbeit begannen und 2003, gemeinsam mit Verdi, das „Netzwerk gegen Mobbing im Großraum Nürnberg“ gründeten.
Nun zogen Verantwortliche von damals und heute, darunter als „Mann der ersten Stunde“ Bernd Schnackig von der Katholischen Arbeitnehmerpastoral, in Nürnberg Bilanz. „Die Methoden sind die Gleichen geblieben“, resümierte Schnackig. Mobbing sei eine konfliktbelastete Kommunikation am Arbeitsplatz unter Kollegen oder zwischen Vorgesetzten und Untergebenen, bei der systematisch und über lange Zeit mit Worten und/oder Taten diskriminiert und ausgegrenzt werde. Mit dieser Definition berief sich Schnackig auf den Wissenschaftler Heinz Leymann, dessen Buch „Mobbing“ 1993 eine breite gesellschaftliche Diskussion ausgelöst hatte.
„Den Begriff Opfer verwenden wir nicht, wir sprechen in der Mobbing-Beratung von angegriffener und angreifender Person“, erläuterte Schnackig, „wir wollen ja dazu befähigen, dass sich Menschen gegen Mobbing wehren“. Im Laufe der Jahre habe er auch erleben müssen, dass Mobbing betrieben wurde, um Belegschaften zu „disziplinieren“ und Mitarbeiter zu veranlassen, „freiwillig“ zu gehen.
Der Druck hat zugenommen
In der Beratungsstelle gegen Mobbing der Katholischen Arbeitnehmerpastoral Herzogenaurach arbeitet Schnackig mit Psychologen zusammen. „Wir beraten Betriebe ebenso wie einzelne Ratsuchende.“ 250 bis 280 Beratungsgespräche verzeichnet die Beratungsstelle im Durchschnitt pro Jahr. „Mobbing ist eine Ausnahmesituation, sie führt in die Isolation“, ergänzte Ingrid Bäumler, die bei Verdi Bezirk Mittelfranken berät. „Wir als Gewerkschaften beschäftigen uns mit den Ursachen von Mobbing“, erklärte die Fachfrau, „der Druck in der Arbeitswelt hat zugenommen“. Konkret bedeute dies, dass sie zum einen Betriebsräte in der Mobbing-Prävention fit mache und in Betrieben interveniere, um zu einem „humanen“ Arbeitsumfeld zurückzuführen, und zum anderen mit Betroffenen in Einzel-Analysen gehe: „Die Menschen sind oft gefangen in ihrer Situation und erkennen nicht, dass es oft an den Strukturen und nicht an ihrer Person liegt.“
Für den Bereich Schulen bilanzierte Marion Müller von der Staatlichen Schulberatungsstelle für Mittelfranken: Man muss systemisch arbeiten, die „schweigende Mehrheit“ im Blick haben. Die Schulpsychologin und Lehrerin setzt daher auf Konzepte wie „Geteilte Verantwortung“ und Stärkung der Zivilcourage. Die Mobbing-Dunkelziffer an Schulen sei sehr hoch, denn Kinder und Jugendliche vertrauten sich kaum Eltern oder Lehrern an. Nach einer Untersuchung von 2010/11 sei davon auszugehen, dass 20 Prozent aller Schüler deutschlandweit schon einmal mit Mobbing konfrontiert wurden. „Eine mobbingfreie Schule ist Illusion.“ Allerdings seien in 90 Prozent aller aufgelösten Mobbing-Fälle die Täter entsetzt, wenn sie mit den Folgen ihres Tuns konfrontiert würden. So könne man durchaus einen Lernerfolg konstatieren, bestätigte Müller auf Nachfrage. Sehr wirksam und nachhaltig sei es beispielsweise, wenn Schulleiter bei Cyber-Mobbing die Polizei einschalteten.
„Wir als Kirche betonen die sozialethische Perspektive“, erklärte Norbert Feulner vom Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt der Evangelisch-Lutherischen Kirche Bayern. Er kritisierte die Rendite-Ausrichtung vieler Unternehmen: „die Gewinnmaximierung macht etwas mit den Menschen“. Das „Wohlfühlen“ am Arbeitsplatz werde immer schwieriger, sagte er und verwies auf Großraumbüros.
„Viel Aufgeschlossenheit bei viel Verhaltensstarre“, mit diesem Zitat des Soziologen Ulrich Beck beschrieb Feulner den Umgang mit Mobbing in der Arbeitswelt. Vorbildcharakter hat für ihn die Dienstvereinbarung der Stadt München. Als wesentlicher Gradmesser für die Beurteilung von Führungskompetenz würden dort der Umgang mit Konflikten und die Mobbingprävention angesehen. Feulner forderte zudem von der Politik und der Rechtsprechung, Mobbing als Form von „psychischer Gewalt“ anzuerkennen. Bisher würde das „Opferentschädigungsgesetz“ bei Mobbing nicht greifen. Die Beweislast liege überdies allein bei den geschädigten Personen.
Gesetzlichen Handlungsbedarf sieht hier auch Bernd Schnackig. Zumal die Kosten für die Allgemeinheit beispielsweise bei Frühverrentung infolge von Mobbing enorm seien. Nach dem Verursacherprinzip müssten die Aggressoren zur Kasse gebeten werden, so Feulner. Aber selbst für das Unternehmen rechne es sich nicht, per Mobbing Mitarbeiter „loszuwerden“, sagte Schnackig. Ein Jahresgehalt müsse man in jedem Fall abschreiben, fand eine Schweizer Beratungsgesellschaft heraus.
Heinrichsblatt Nr. 16 vom 20.04.14 - Ausgabe A, Seite 25