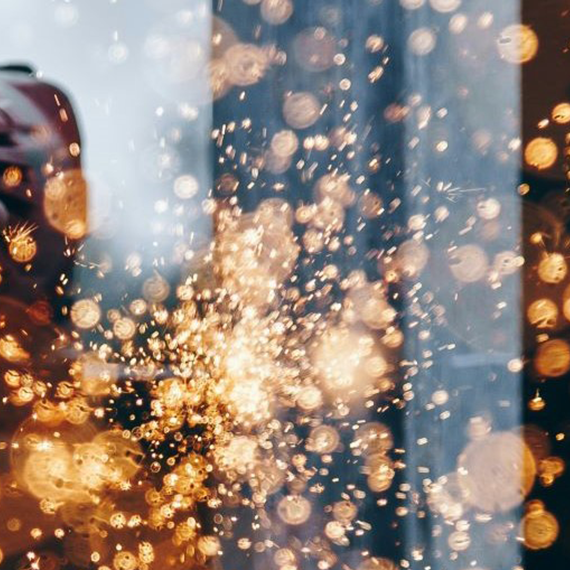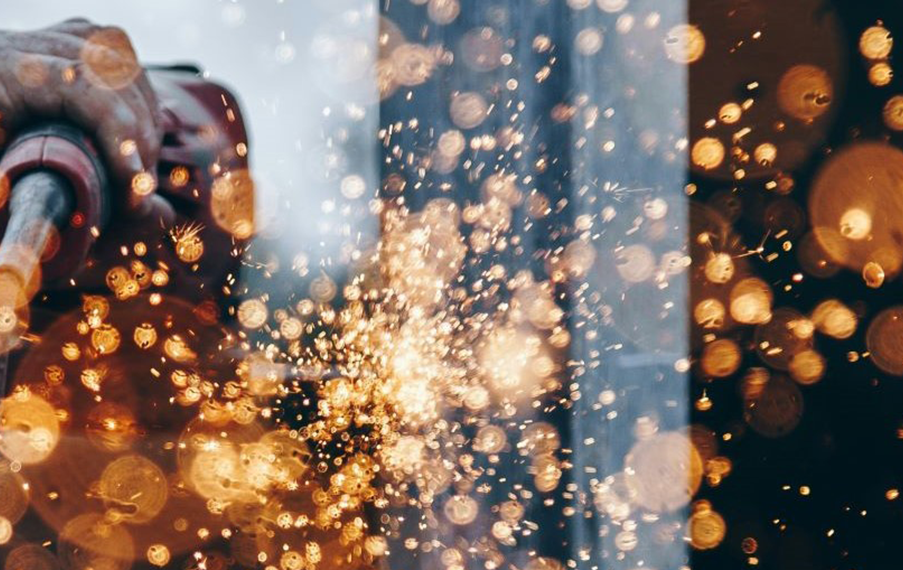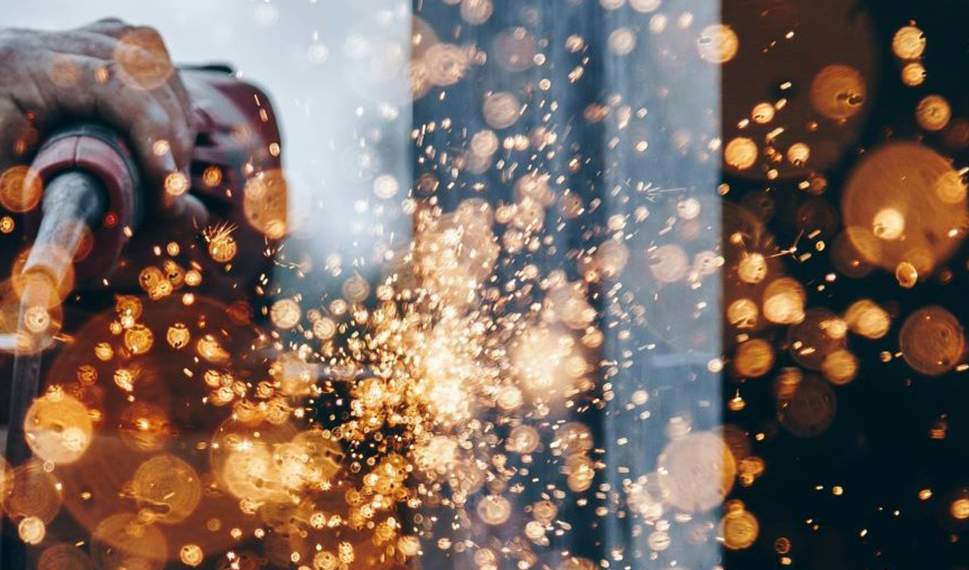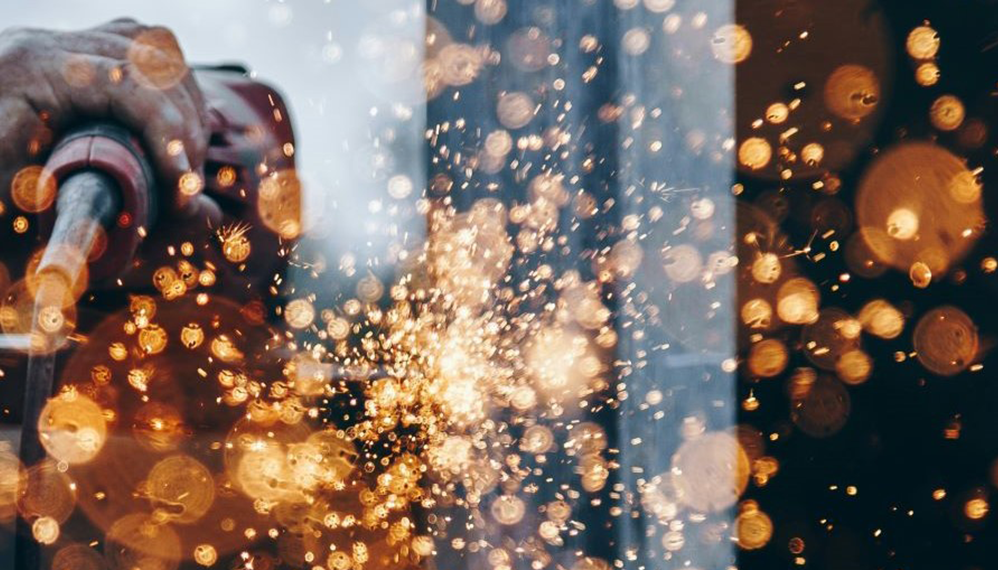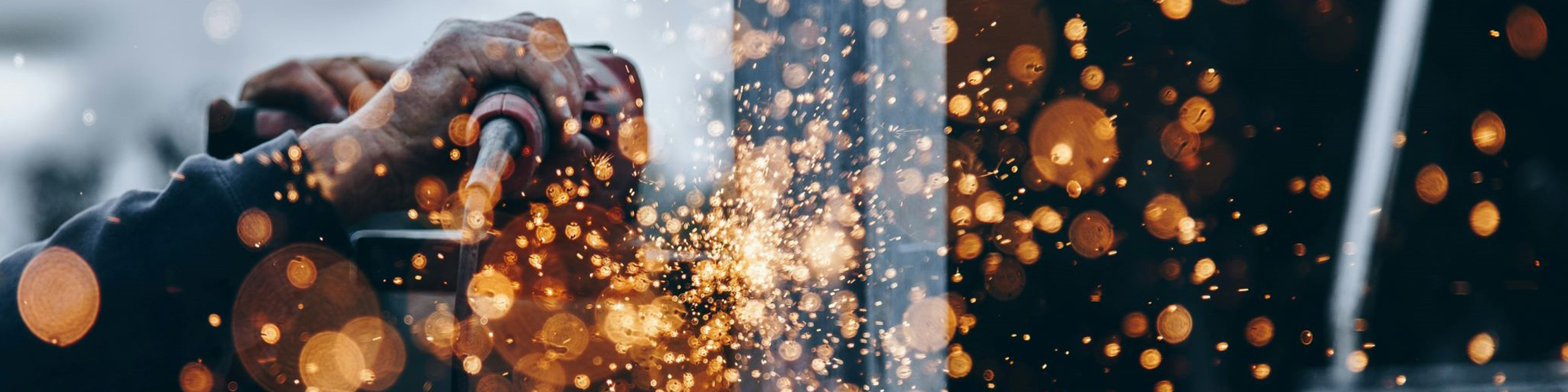40 Jahre Synodenbeschluss „Kirche und Arbeiterschaft“
Sehr verehrte Festgäste,
am 20. November 1975 war es endlich soweit. Im Würzburger Dom wurde die Vorlage „Kirche und Arbeiterschaft“ mit überwältigender Mehrheit der Synodalen angenommen. Von den bei der Schlussabstimmung anwesenden 267 Würzburger Synodenmitgliedern stimmten 216 mit Ja, 29 mit Nein und 22 enthielten sich ihrer Stimme.
Vorausgegangen waren, studiert man die Berichte, harte, oft dramatische, in jedem Fall leidenschaftliche Diskussionen.
• Wie steht die Kirche zur Arbeiterschaft heute?
• Was ist überhaupt die Arbeiterschaft? Was macht sie aus?
• Was lässt sich tun, um den „fortwirkenden Skandal“ der Trennung von Kirche und Arbeiterschaft zu überwinden?
Und solche Fragen mehr.
Kardinal Cardijn hatte, nicht auf die Deutsche Synode bezogen, die Problematik auf den Punkt gebracht: „Eine Kirche ohne Arbeiterschaft ist nicht die Kirche Christi“. Die Synodalen haben diese Aussage sehr ernst genommen und miteinander nach Wegen gesucht, Kirche und Arbeiterschaft wieder miteinander ins Gespräch zu bringen, historisch gewachsene Entfremdungen abzubauen und beide letztlich miteinander zu versöhnen.
Die Synode begann mit einer Gewissenserforschung: „Was haben wir, die wir die Kirche sind, oder unsere Vorgänger nicht richtig gemacht, dass es der Arbeiterschaft schwer gefallen ist und selbst gläubigen katholischen Arbeitern heute noch schwerfällt, ein zutreffendes Bild der Kirche zu gewinnen und sich als von ihr verstanden anzusehen und gerecht behandelt zu fühlen?“
Ganz auf der Linie des 2. Vatikanischen Konzils suchte man den Dialog, und zwar keinen strategischen oder besserwisserischen, sondern einen ganz ehrlichen Dialog unter Zeitgenossen. Und dieser Dialog hat –sicherlich in unterschiedlicher Intensität und Ausprägung- bis heute angehalten. Auch die Veranstaltung heute Abend ist ein inzwischen ganz selbstverständliches Treffen in der Perspektive der Würzburger Synode.
Viele Aspekte ließen sich jetzt aufnehmen und vertiefen. Ich kann hier nur drei ansprechen und die auch mehr anreißen als zufriedenstellend behandeln.
1. Heute ist manchmal zu hören: Die Arbeiterschaft, von der die Würzburger Synode spricht, gibt´s doch gar nicht mehr. Inzwischen sind 40 Jahre ins Land gegangen mit Wohlstandszuwächsen auch bei der Arbeiterschaft. Die Interessensgegensätze sind doch längst abgemildert. Der Begriff „Arbeiterschaft“ klingt doch gar zu sehr nach Proletariat. Da sind wir doch meilenweit davon entfernt. Heute kann sich doch auch ein Arbeitnehmer einen guten Mittelklassewagen leisten. Und so spricht man lieber von verschiedenen Milieus und ihren jeweiligen Charakteristika. Wertüberzeugungen, Kaufverhalten und Geschmacksfragen stehen dabei im Vordergrund. Auch in den Kirchen greift man inzwischen gern auf dieses Erklärungsmuster gesellschaftlicher Unterschiede zurück, um daraus Erkenntnisse für die Pastoral zu gewinnen.
Was bei dieser Herangehensweise aber oft zu kurz kommt, ist die Tatsache, dass zwischen den Milieus -das lehrt die gesellschaftliche Erfahrung- verschiedene strukturelle Machtgefälle bestehen, die zur Folge haben, dass die einen mächtiger und reicher, die anderen ohnmächtiger und ärmer werden. So stimmt der Satz aus dem Synodenpapier auch heute uneingeschränkt: „Die Lebenslage der abhängigen Arbeit, insbesondere wenn es sich um niedrig geschätzte und als solche – unbilligerweise – auch niedrig entlohnte Arbeit handelt, deklassiert auch heute noch.“
Das scheint mir ein unaufgebbares Erbe des Synodenbeschlusses zu sein, dieses „Machtungleichgewicht“ in sehr realistischer Weise in den Blick zu nehmen und sich die Sicht nicht vernebeln zu lassen von wirtschaftlichen Erfolgszahlen.
2. Es geht dem Synodenpapier nicht um eine falsch verstandene, allzu forsche Missionierung der Arbeiterschaft, so als müsste man nur lange genug im Guten auf sie einreden, damit sie ihre Vorbehalte überwinden und in den Schoß der Kirche zurückkommen, und dann wäre doch alles in Ordnung. Das Synodenpapier ist sensibel genug, die jeweiligen Lebenswelten, den Erfahrungskosmos und den Eigenwert der Arbeiterschaft anerkennend in den Blick zu nehmen und Anknüpfungspunkte zu erkennen. Theologisch ausgedrückt: Es geht darum, die Spuren des Reiches Gottes in der Welt der Arbeit zu entdecken. Denn das Reich Gottes ist längst dort, möglicherweise verborgen und incognito, aber es muss zumindest nicht erst hingetragen werden. Oder in der Sprache des Synodenpapiers. „Arbeiterpastoral muss offenlegen: Durch kollegiales Verhalten im Betrieb, durch Hilfe in der Nachbarschaft, durch Liebe in der Familie erfüllt ihr bereits das Evangelium.“
3. Natürlich ist der Synodenbeschluss „Kirche und Arbeiterschaft“ an vielen Stellen sehr seiner Zeit und ihren Fragestellungen verhaftet. Manches, vielleicht sogar vieles würde man heute so nicht mehr sagen. Und doch ist hinter den Formulierungen die Ehrlichkeit und Lauterkeit des Anliegens zu spüren: „Alle, die Kirche sind, müssen bereit sein, alles zu fördern, was zu einer gesellschaftlichen Ordnung führt, in der die Arbeiterschaft ihren gleichberechtigten Platz hat und im Vollmaß sich als mitverantwortlich für das Gemeinwohl verstehen kann.“
Auch 40 Jahre später wird man diesem Satz inhaltlich zustimmen können, wenngleich angesichts der Situation in der Arbeitswelt eine solche Zustimmung im Halse stecken bleiben will. Das Umsichgreifen prekärer Beschäftigung, verbunden mit existenzgefährdender Bezahlung und der unausweichlichen Bedrohung durch Hartz IV lassen das geforderte Vollmaß der Mitverantwortung am Gemeinwohl nur schwer erkennen. Heute braucht es andere, situativ treffendere Worte.
Umso dankbarer dürfen wir deshalb für das gegenwärtige Pontifikat sein. Papst Franziskus hat mit seinem Apostolischen Schreiben „Evangelii Gaudium“ den Finger tief in diese Wunde gelegt. Natürlich hat er die Weltgesellschaft im Blick, aber sein „Nein zu einer Wirtschaft der Ausschließung und der Disparität der Einkommen“ trifft auch die Situation in unserer Gesellschaft
40 Jahre „Kirche und Arbeiterschaft“ ist zugegebenermaßen kein rundes Jubiläum. Aber die Anliegen, die mit diesem Papier verbunden sind, sollten wir uns bewahren – ganz unabhängig von jeder Zahl.