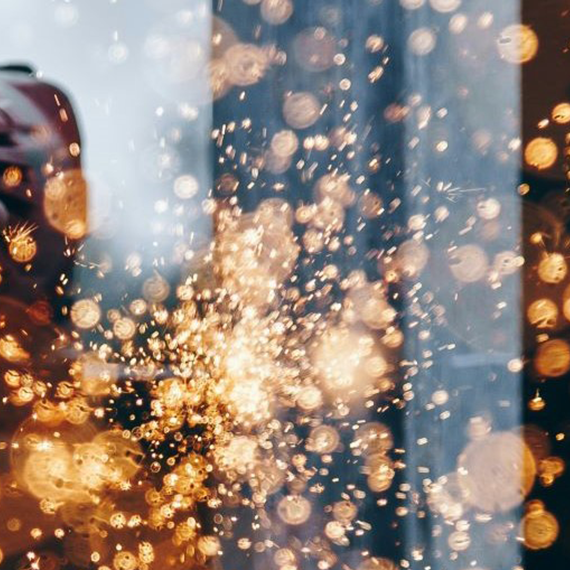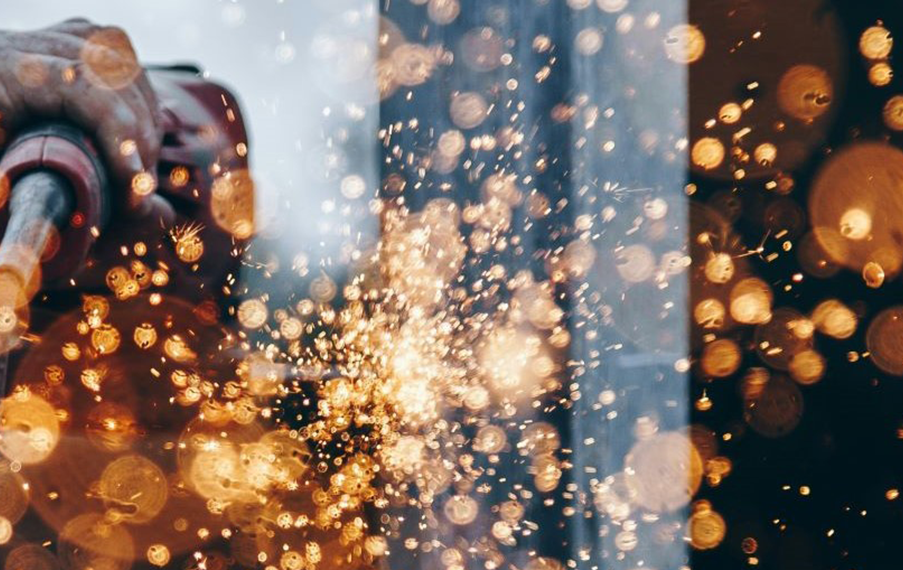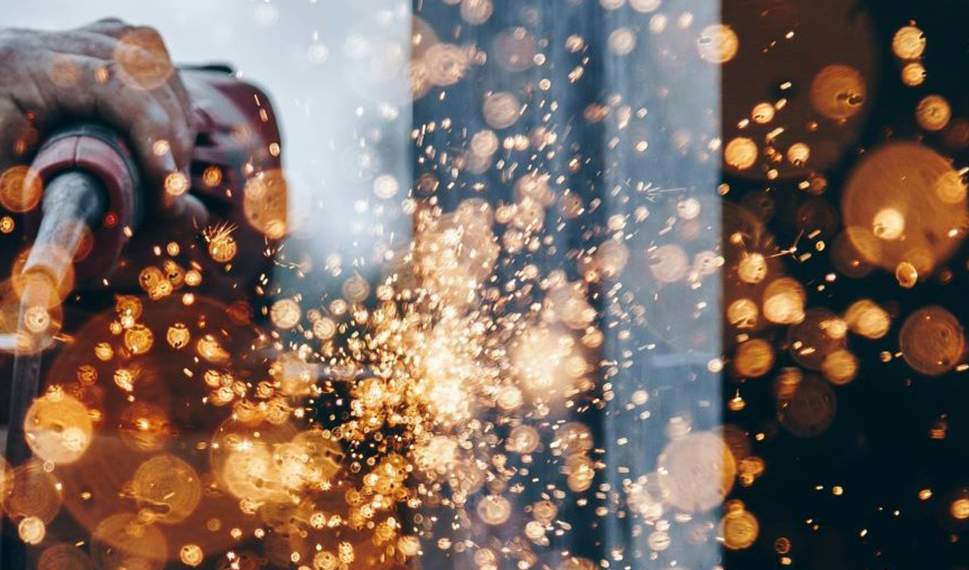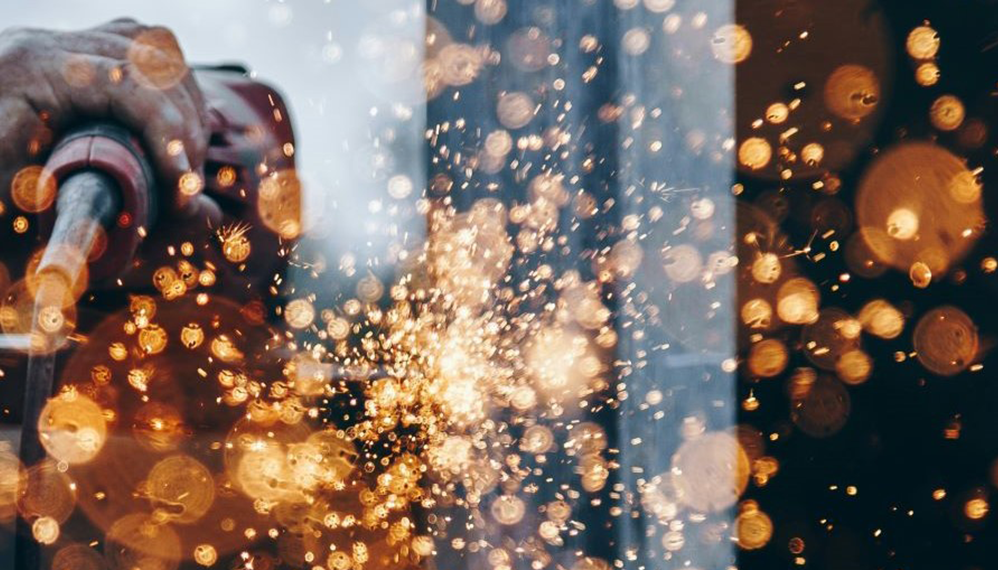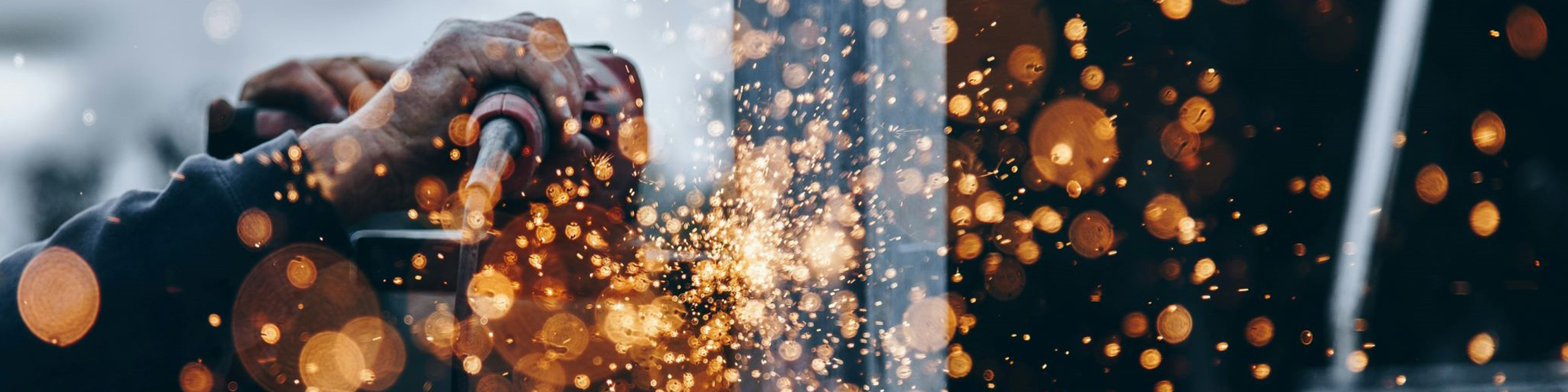"Der Mensch muss in Würde arbeiten können"
Begegnung: Erzbischof Ludwig Schick diskutierte hauptamtlichen Gewerkschaftlern über „gute Arbeit“.
So viel steht fest: Die alten Berührungsängste zwischen Kirche und Gewerkschaften sind überwunden. Erzbischof Ludwig Schick und Gewerkschaftssekretäre aus dem Gebiet der Erzdiözese begegneten sich jetzt im Bistumshaus St. Otto mit gegenseitiger Wertschätzung. „Aus kirchlicher Sicht sind Gewerkschaften unbestritten und unbestreitbar“, erklärte denn auch der Erzbischof. Und die Gewerkschaftler begrüßten ausdrücklich diese Chance zum Austausch. In dem zweistündigen Gespräch kristallisierte sich deutlich der gemeinsame Nenner heraus: „Der Mensch in seiner Würde muss in der Arbeitswelt im Vordergrund stehen.“ – „Was ist gute Arbeit?“ stand als Ausgangsfrage über dem Treffen, das die diözesane Betriebsseelsorge initiiert hatte. Eine Antwort gaben in kurzen Statements Volker Seidel von der IG Metall Ostoberfranken und Rita Wittmann von Ver.di Nürnberg: „Gute Arbeit“ erhält die Leistungsfähigkeit, ist altersgerecht ausgestattet, bedeutet Mitbestimmung, sichert ein verlässliches Einkommen und die Gesundheit, nimmt Rücksicht auf die Familie. „Ohne starke Betriebsräte und Gewerkschaften läuft dabei nichts,“ ergänzte Seidel.
In Anlehnung an die katholische Soziallehre sprach Betriebsseelsorger Manfred Böhm vom notwendigen „gerechten Lohn, um in Würde leben zu können“ und vom Recht auf „menschengerechte Arbeitsbedingungen und Solidarisierung in Arbeitnehmerbewegungen“. „Gute Arbeit“ bedeute auch einen „sorgsamen Umgang mit der Schöpfung und den Lebensgrundlagen“ sowie eine „regelmäßige Unterbrechung“(Sabbat) zur Erholung.
Erzbischof Schick brachte noch eine andere Dimension ins Spiel, die er den Gewerkschaftlern als Handlungsprinzip nahe legte. Die Beachtung der vier Kardinaltugenden könne „gute Arbeit der Gewerkschaften“ ausmachen. „Gerechtigkeit“, ohne die nichts funktioniere, dürfe nicht nur verteilen bedeuten, sondern müsse global alle Menschen in den Blick nehmen. „Tapferkeit“ meine, tapfer den Aufschwung weiter zu verfolgen und auf Nachhaltigkeit zu schauen. „Maß“ heiße nicht, ohne Rücksicht auf Verluste zu verteilen, sondern sich zu Gunsten nachfolgender Generationen zu mäßigen. Und die „Weisheit“ ließe über ein „Mein und Hier“ hinausschauen und pflege internationale Beziehungen etwa zu Afrika und Asien. Der Erzbischof forderte die Gewerkschaftler dazu auf, „den großen Horizont im Hinterkopf zu behalten“. Nach seinen Worten könnten die Gewerkschaften besser wirken, wenn sie die „weite Sicht mehr miteinander besprechen und nach außen geben“ würden.
In der Tat beklagten die Sekretäre das Bild der Gewerkschaften als reine „Verteilungsmaschine“ in der Öffentlichkeit. Einig waren sie sich darin, dass mehr über Werte und ethische Grundlagen in Wirtschaft und Arbeitswelt geredet werden müsste. Und sie brachten eine Lanze für die zahllosen Arbeitnehmer, die bereits heute die Kardinaltugenden beherzigen. Dies in einer Zeit mit Angst um den Arbeitsplatz, mit befristeten Einstellungen, Leiharbeit, unbezahlten Praktika, prekärer Beschäftigung mit Gesundheitsrisiko und ungleichen Löhnen für gleiche Arbeit. „Das Kapital dominiert, der Mensch wird nicht mehr gesehen“, sah ein Gewerkschaftler den Ist-Zustand weit weg von „guter Arbeit“. Er und seine Kollegen wollen bei ihrer Verwirklichung am Ball bleiben.