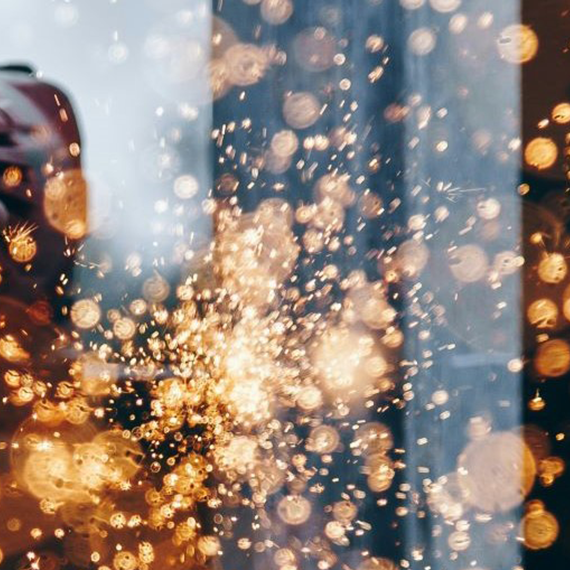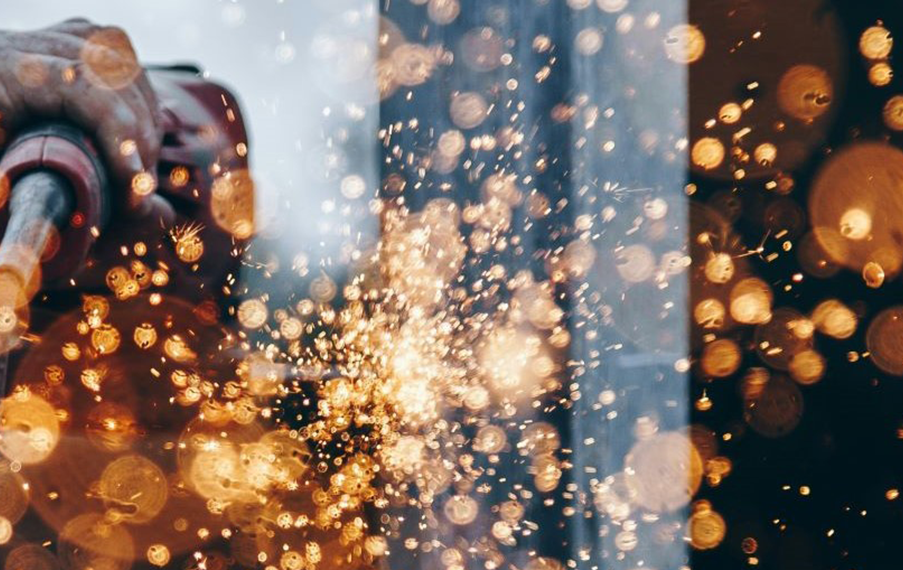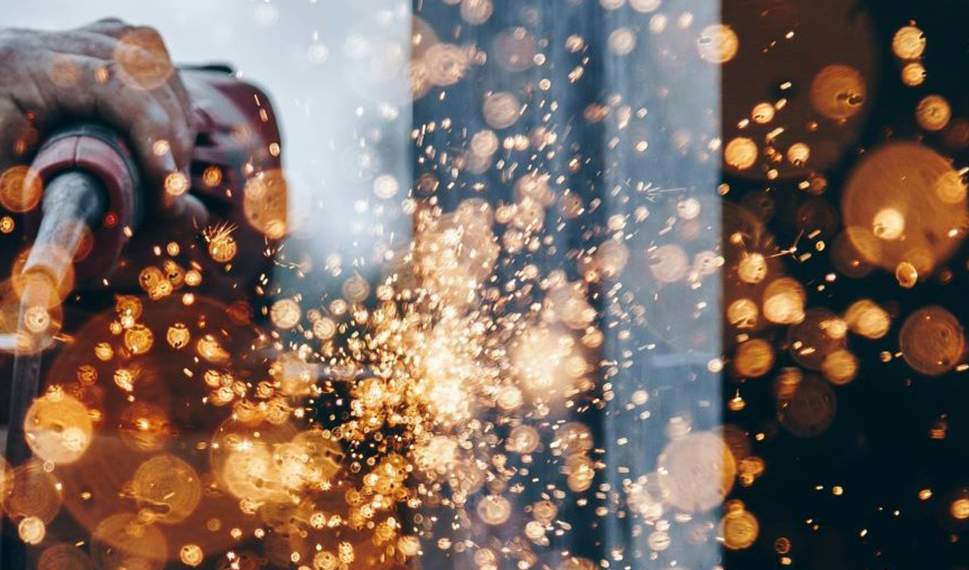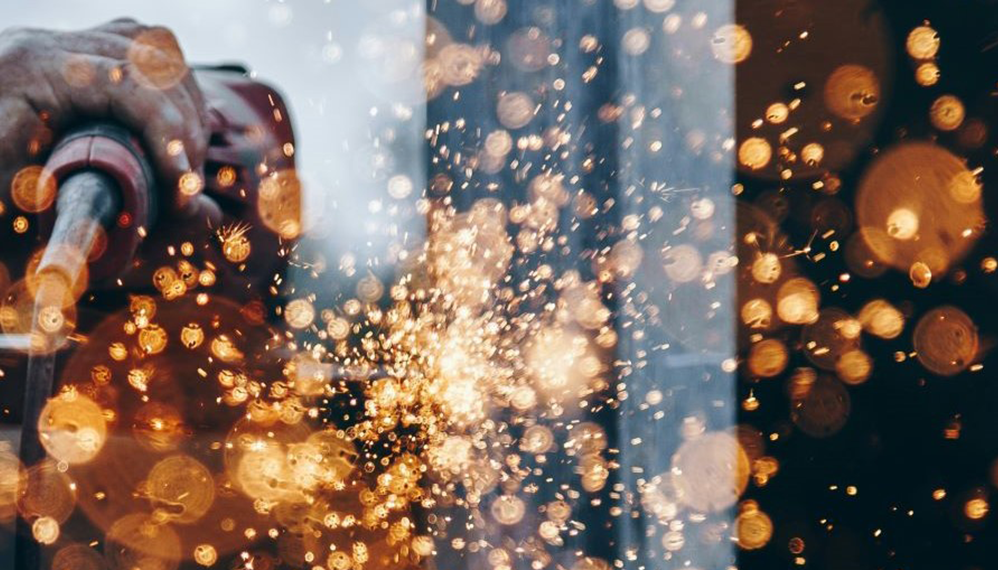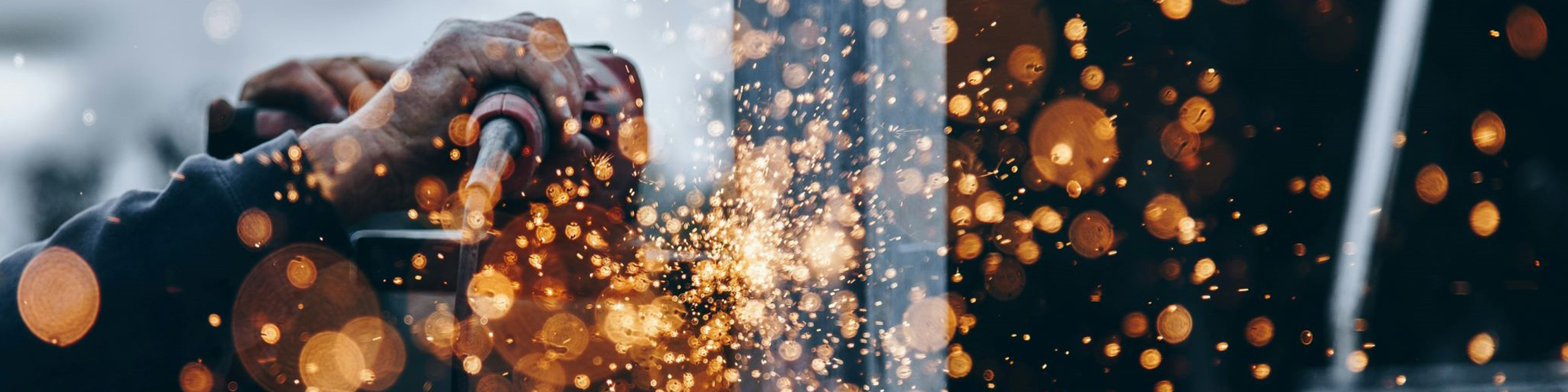Es ist ein „Fürsorge-Arbeitnehmer“ entstanden

Sozialethiker Segbers sprach bei der Betriebsseelsorge über das Menschenrecht auf gerechten Lohn
Über das Thema „Gerechter Lohn – ein Menschenrecht?“ sprach Dr. Franz Segbers, Professor für Sozialethik, im Bistumshaus St. Otto bei der traditionellen Betriebsräte-Runde der Betriebsseelsorge des Erzbistums Bamberg. Gebe es ein Menschenrecht auf gerechte Löhne, fragte der Professor. Ja, es sei ein elementares Menschenrecht. Allerdings sei eine ständige Menschenrechtsverletzung in den Betrieben zu beobachten.
Die Forderung nach einem Recht auf Arbeit sei von Anfang an eine zentrale Forderung der Arbeiterbewegung, betonte Segbers. Das Recht auf Arbeit habe nach dem Ersten Weltkrieg ihren Niederschlag in der Weimarer Verfassung und nach dem Zweiten Weltkrieg in den Länderverfassungen der Bundesrepublik gefunden. So heiße es in der 1946 verabschiedeten Bayerischen Verfassung in Artikel 166: „Jedermann hat das Recht, sich durch Arbeit eine auskömmliche Existenz zu schaffen.“ Auch in zahlreichen Völkerrechtsquellen sei diese „Urforderung der Gewerkschafts- und Arbeiterbewegung fest verankert.“
Das habe nach dem Krieg dazu geführt, dass Armut bei uns weithin verschwand. So sei bis 1972 Leiharbeit gänzlich verboten und befristete Arbeitsverträge bis 1985 nur unter strengen Auflagen möglich gewesen. Kaum war der wirtschaftliche Zenit erreicht, habe auch schon der Niedergang mit arbeits- und sozialrechtlichen Gegenreformen begonnen. Die Folge sei, dass die überwunden geglaubte Prekarisierung der Arbeit wieder zurückkehrte. „Die Erschütterung der Erwerbsarbeit hat ihre Hauptursache in der sukzessiven Auflösung des Normalarbeitsverhältnisses.“
Heute steige zwar die Beschäftigung und die Arbeitslosigkeit sinke, doch das verdecke nur eine tiefgreifende Krise. Normalarbeitsverhältnisse würden immer weniger. Selbst die Vollzeitbeschäftigung in den unteren Lohngruppen schütze nicht mehr vor Armut. Erwerbsarmut entstehe. Es sei ein „Fürsorge-Arbeitnehmer, der erwerbstätig ist und dennoch auf Fürsorge angewiesen ist,“ entstanden. Arbeitslosigkeit versuche man dadurch zu bekämpfen, „dass die Unternehmen die Möglichkeit haben, Billigformen von Arbeit und Beschäftigung anzubieten und den Niedriglohnsektor auszuweiten“. Aus der Gesellschaft des Aufstiegs sei eine Gesellschaft des sozialen Abstiegs geworden. Fast jeder Vierte arbeite für einen Stundenlohn unterhalb der Niedriglohnschwelle. Über 1,3 Millionen Erwerbstätige müssten ihre Arbeit aufstocken, jeder dritte Aufstocker habe eine Vollzeitarbeitsstelle. Trotz Arbeit seien sie Fürsorgeempfänger.
Segbers kritisiert die „exorbitant unverschämten Gehälter“ einiger Unternehmenschefs. Sie verdienten 147 mal so viel wie ein Arbeiter. Die Spitzengehälter hätten sich in fünf Jahren um 40 Prozent erhöht.
Mittlerweile werde der Lohn als Preis der Ware Arbeitskraft angesehen. Der Lohn werde also an die Marktlage gekoppelt. „Das Marktprinzip verdrängt nicht nur das Leistungsprinzip, sondern auch das dem Tarifvertrag zugrunde liegende Gleichheitsprinzip“, betonte der Professor.
Die christliche Sozialethik habe in der katholischen Soziallehre immer an der Forderung nach Lohngerechtigkeit festgehalten. Papst Leo XIII habe sich in der Enzyklika „Rerum Novarum“ (1891) und Pius XI in „Quadragesimo anno“ (1931) ausdrücklich für die Lohngerechtigkeit eingesetzt. Johannes Paul II betone in seiner Enzyklika „Laborem Exercens“ (1981), für ihn sei die Frage nach dem gerechten Lohn der „Dreh- und Angelpunkt der Sozialethik“ und der „Prüfstein für die Gerechtigkeit des gesamten ökonomischen Systems und für sein rechtes Funktionieren“. Er habe einen familiengerechten Lohn gefordert.
Aus sozialethischer Sicht gebe es folgende Kriterien für einen gerechten Lohn: Leistung, Lebenslage, Solidarität. Aber es gebe keinen objektiven, von außen anlegbaren Maßstab, der Auskunft über Gerechtigkeit von Löhnen geben könne. „Voraussetzung für einen gerechten Lohn ist eine pritätische Gleichgewichtigkeit der Verhandlungspartner. Gerecht kann ein Lohn nur gelten, der durch ein gerechtes Verfahren zustande gekommen ist, bei dem beide Seiten – Arbeitgeber und Gewerkschaften – mit paritätisch gleicher Macht ausgestattet eine Einigung erzielt haben. Sowohl sozialethisch wie auch juristisch kann deshalb von einer ,Richtigkeitsgewähr‘ der Lohnhöhe nur bei gleichgewichtigen Verhandlungen ausgegangen werden“, unterstrich Segbers.
Der Redner legte auch klar, dass das Menschenrecht auf Arbeit im Arbeitsvölkerrecht vielfältig festgeschrieben sei. So stehe in der 1948 von der UN-Generalversammlung verabschiedeten Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte in Artikel 23: „Jeder, der arbeitet, hat das Recht auf gerechte und befriedigende Entlohnung, die ihm und seiner Familie eine der menschlichen Würde entsprechende Existenz sichert, gegebenenfalls ergänzt durch andere soziale Schutzmaßnahmen“. Der UN-Sozialpakt von 1966 lege in seinem 7. Artikel dann noch das Recht eines jeden auf gerechte und günstige Arbeitsbedingungen sowie angemessenen Lohn und gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit und einen angemessenen Lebensunterhalt für die Arbeitenden und ihrer Familien fest.
Zum Schluss unterstrich der Professor nochmals: „Was ein gerechter Lohn ist, lässt sich nicht von außen bestimmen und ergibt sich auch nicht aus Angebot und Nachfrage, sondern muss auch durch gerechte Verfahren erkämpft werden. Dazu dient die Tarifautonomie. Gerecht ist jener Lohn, der von gleich starken Tarifvertragsparteien ausgehandelt wurde.“ Hungerlöhne, prekär gemachte Arbeit, überlange Arbeitszeiten oder mangelnde soziale Sicherheiten sind „Ausdruck von Menschenrechtsverletzungen“.
Zum Dank überreichte Dr. Manfred Böhm, Leiter der Betriebsseelsorge des Erzbistums, Segbers zu dessen Vergnügen einen Bamberger Reiter von Playmobil und einen Gedichtband über die Arbeitswelt.
Nach diesem informativen Teil tauschten sich die Betriebsrats- und Personalrats-Mitglieder über die Situationen in ihren Betrieben aus.