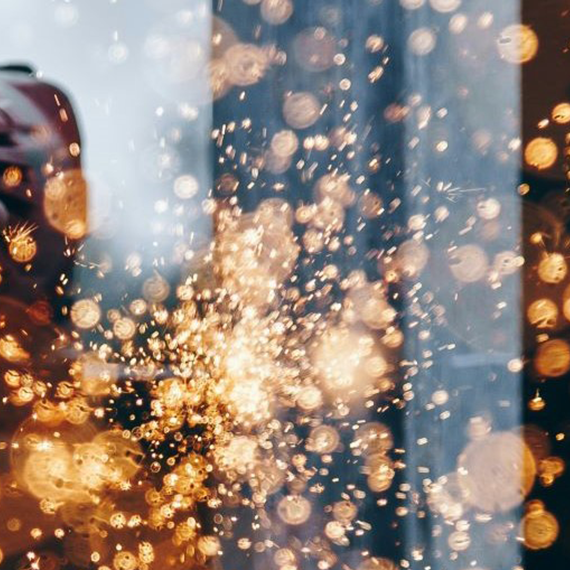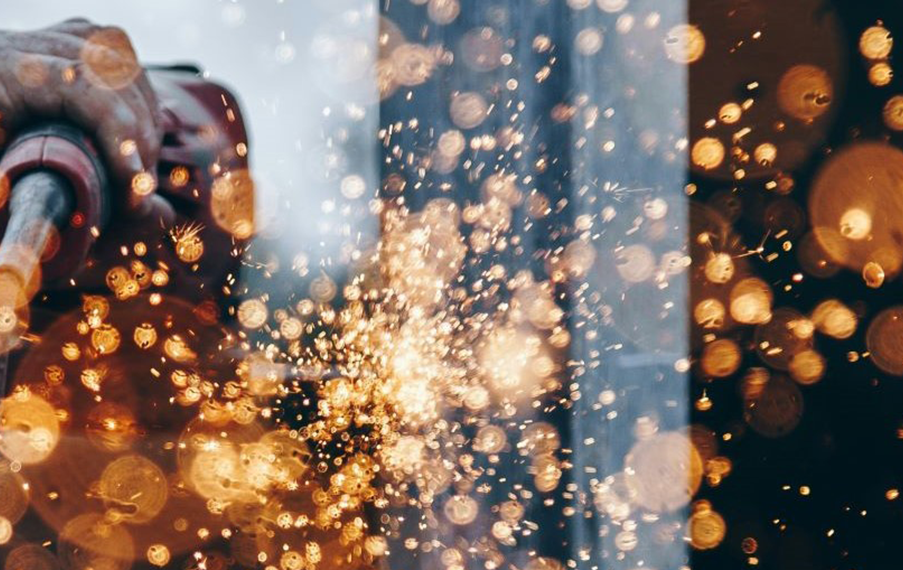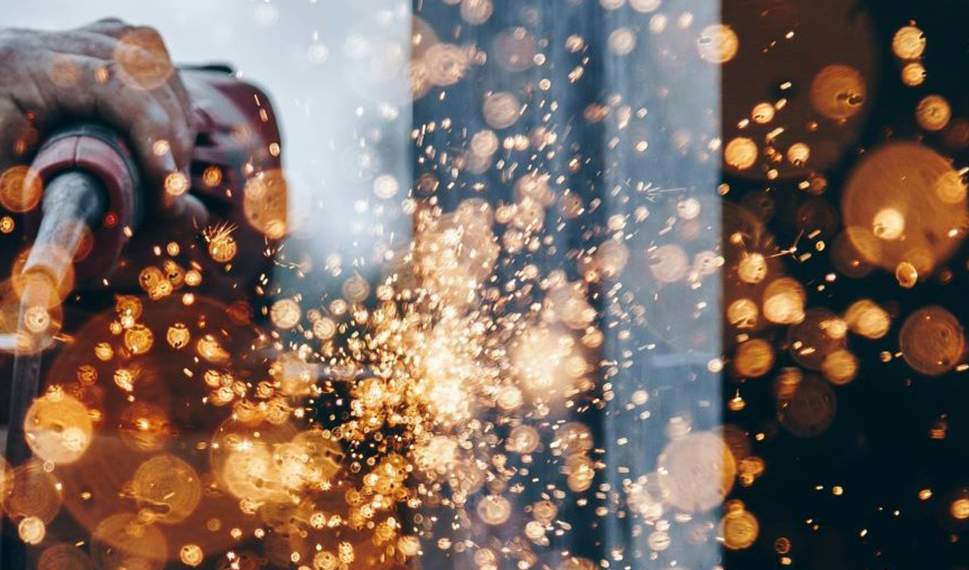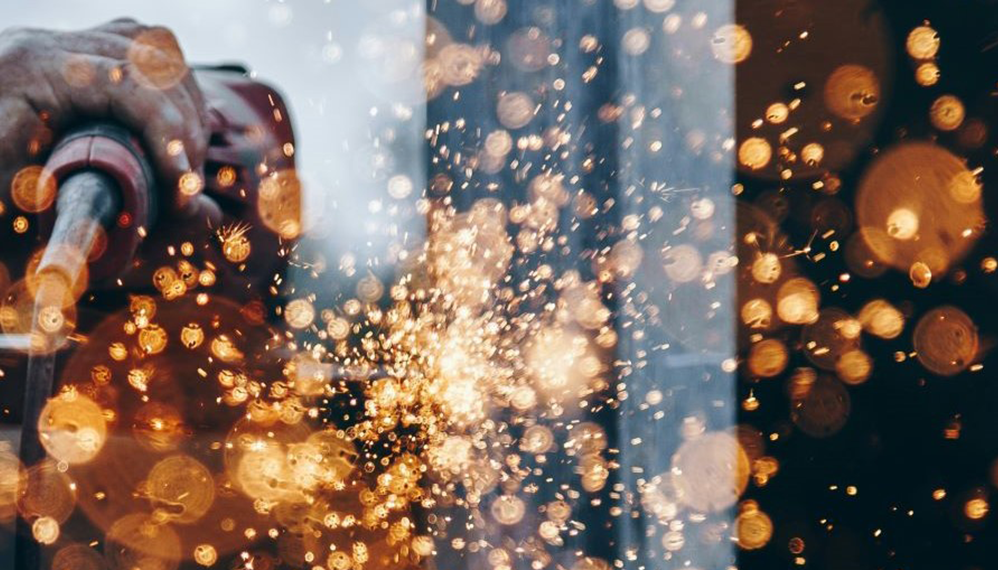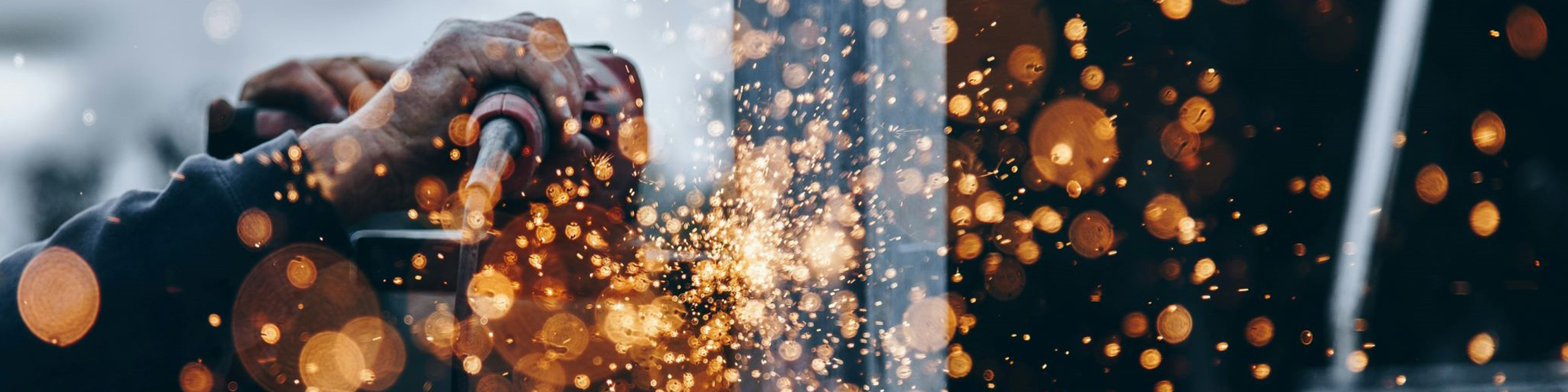„Marx und der Papst haben dieselbe Quelle“
Diskussion mit Diözesanbetriebsseelsorger Dr. Manfred Böhm und Harald Weinberg von den Linken
Was Papst Franziskus im apostolischen Schreiben „Evangelii gaudium“ über soziale Gerechtigkeit sagt, ist nicht neu. Neu ist, dass seine Worte auch in kirchenkritischen Milieus Beifall finden, und Bibelworte neuerdings sogar im Bundestag zitiert werden – von der Partei Die Linke. Grund genug für Manfred Böhm, Leiter der Katholischen Arbeitnehmerpastoral im Erzbistum Bamberg, mit Linken- Bundestagsabgeordneten Harald Weinberg in der Nürnberger Villa Leon über „Soziale Gerechtigkeit – Katholische Kirche und Linke einer Meinung?“ zu diskutieren.
„Wenn das Oberhaupt einer Weltreligion so etwas in die Welt setzt, dann muss man sich damit auseinandersetzen“, sagte Harald Weinberg, den die „Härte der sozialen und wirtschaftlichen Analyse des Papstes“ hatte aufhorchen lassen. Christen hätten sich damit in ihrer Meinungsbildung sowieso auseinanderzusetzen, antwortete Manfred Böhm. Und er stellte klar: Das Papstschreiben sei, anders als oft in den Medien verlautbart, kein Plädoyer für ein neues Kirchen- und Amtsverständnis, sondern rücke nur eine alte christlich-jüdische Tradition wieder neu in den Blick.
Eigentum verpflichtet
„Die Sozialpflichtigkeit des Eigentums hat ihren Ursprung in der Bibel“, sagte er. Denn das starke Gerechtigkeitsempfinden der Israeliten, das sich meist an der drückenden Ungerechtigkeit in Zeiten der Knechtschaft entzündete, sei bis heute gemeinschaftsstiftend geblieben.
„Erschwert den Leuten die Arbeit, dann sind sie beschäftigt und kümmern sich nicht um Geschwätz.“ Der Satz hätte schon unter den Fronherren der Israeliten gegolten, sagte Böhm. Heute setze man sie durch Normerhöhung und Leistungsdruck durch.
Damals wie heute ziele alles Eintreten für Gerechtigkeit darauf, den Menschen wieder in den Mittelpunkt des Arbeitens und Wirtschaftens zu stellen.
„Am Ursprung der Finanzkrise steht die Leugnung des Vorrechts des Menschen“, zitierte Böhm den Papst. Dessen Kritik an der „Herrschaft des Geldes“ ziele vor allem auf die neoliberale Wirtschaftstheorie. „Die so genannte Pferdeäpfeltheorie“, warf Weinberg ein. Sie besage: Wenn es den Reichen gut geht, falle auch etwas für die Armen vom Tisch ab. „Nachgewiesen werden konnte das bisher nicht“, sagte Böhm.
„Diese Wirtschaft tötet“, sage der Papst deshalb zu Recht. In neoliberalen Kreisen gelte der Papst als wirtschaftsfeindlich, sagte Böhm. „Franziskus kommt aber auch aus einer Weltgegend, in der Menschen für diese Wirtschaftslogik sterben. Er vertritt die Sicht der Menschen am Rand.“
Nur von Ausbeutung zu sprechen genüge inzwischen nicht mehr, die Menschen würden ausgeschlossen, aussortiert, zitierte Böhm weiter. Menschen würden gar zu „Abfall“.
Weinberg unterfütterte das drastische Bild mit Zahlen aus Deutschland: „Wir bewegen uns auf Zweidrittel- oder bestenfalls Vierfünftel-Gesellschaft zu.“ Ein Teil der Menschen werde systematisch aus dem Arbeitsmarkt entsorgt, und damit aus der Mitte der Gesellschaft. Er sei froh, dass der Preis der Arbeitskraft hierzulande noch staatlich reguliert werde. Doch die Neoliberalenwürden auch hier einen Marktpreis durchsetzen wollen, sagte er im Blick auf die stets schwierigen Tarifverhandlungen gleich welcher Branche.
Böhm lobte die drastischdeutlichen Bilder des Papstes. „Wir in Deutschland sind es gewohnt, mehrheitsfähig, verbindlich und nicht ausgrenzend zu formulieren. Das ist dem Papst wurscht. Man stockt auch, weil er klar benennt.“
Strukturelle Ursachen
Weinberg beeindruckte, dass mit Papst Franziskus sich die Kirche nicht mehr nur solidarisch zeige und „kümmere“, sondern die strukturellen Gründe für Armut beseitigen wolle. „Das spricht auch Nicht-Gläubige an“, sagte er.
Ihm fiel dazu der Bestseller des Münchener Erzbischofs und Kardinals Marx ein: „Das Kapital“, das der Linken-Politiker natürlich als Replik auf Karl Marx las. „Natürlich“, bestätigte ihn Manfred Böhm. „Die beiden haben dieselbe Quelle. Auch Marx kannte seine Bibel. Das ist die gleiche Tradition.“
Biblisch gedacht habe der Arme ein Recht auf Beteiligung und Versorgung. Heute gelte allerdings: Nichts geleistet, aber kassieren, nahm Böhm eine gängige Mentalität aufs Korn. „In der israelitischen Gesetzgebung gab es alle sieben mal sieben Jahre ein Jubeljahr. Dann wurde das Land neu verteilt, Schuldnern ihre Schulden erlassen. Der Grund: Keiner konnte Grund und Boden für sich beanspruchen. Das Land war von Gott nur geliehen“, nannte Böhm ein letztes Beispiel der Bibel.
„Wir allerdings sind in der Tradition der römischen Gesetzgebung großgeworden: Eigentum ist unantastbar.“
Christlich gedacht müsse es aber heißen: Der Mensch ist zu erhalten, nicht der Besitz. Die Forderung der Arbeit als Menschenrecht sei übrigens ebenfalls biblischen Ursprungs: Während Römer und Griechen zumindest körperliche Arbeit als Übel ansahen, bedeutete sie den Juden eine Form der Weltgestaltung.
Widerstand errege die katholische Lehre jetzt eigentlich nur noch in ihrem Familien- und Frauenbild, sagte Weinberg am Ende des Gesprächs. Manfred Böhm zog ihm den Zahn sofort: Man dürfe nicht glauben, nur weil er auf sozialem Gebiet sehr fortschrittlich denke, sei das in anderen Punkten auch. Zölibat und Frauenpriestertum würden vom Reformwillen des Papstes sicher nicht erfasst.
Quelle: Heinrichsblatt, Blickpunkt Kirche für Nürnberg, Fürth, Erlangen, Neunkirchen am Sand, Ausgabe 12 vom 23. März 2014.