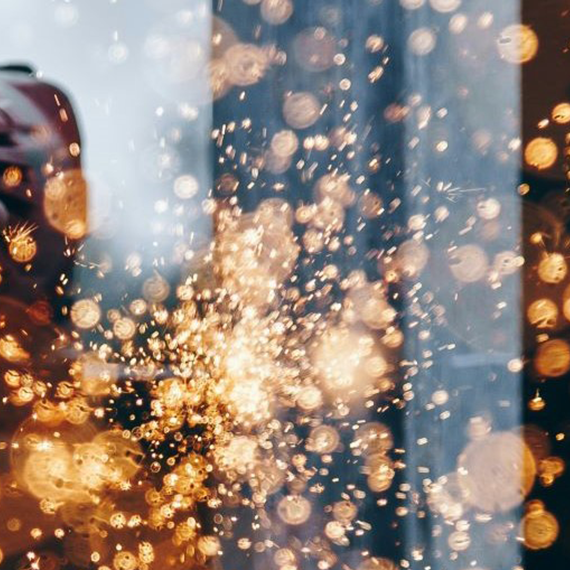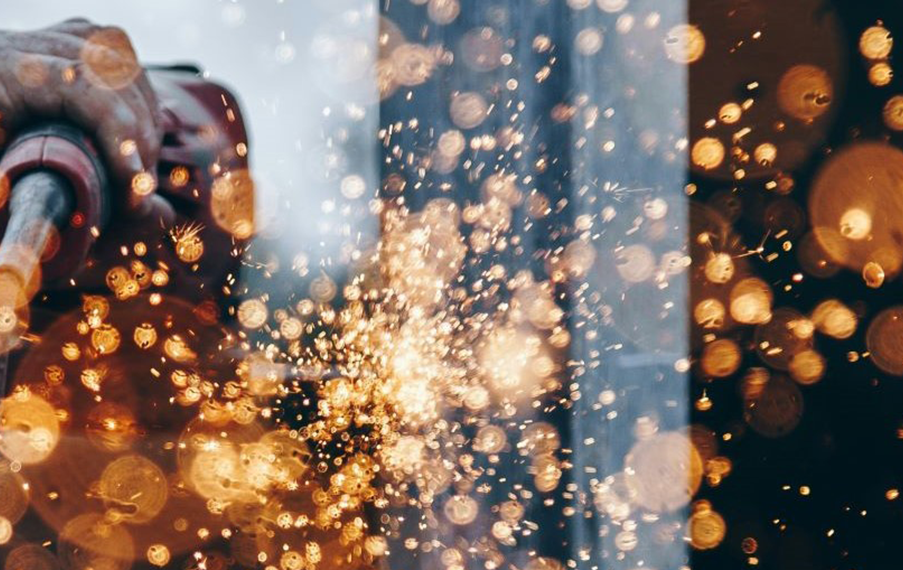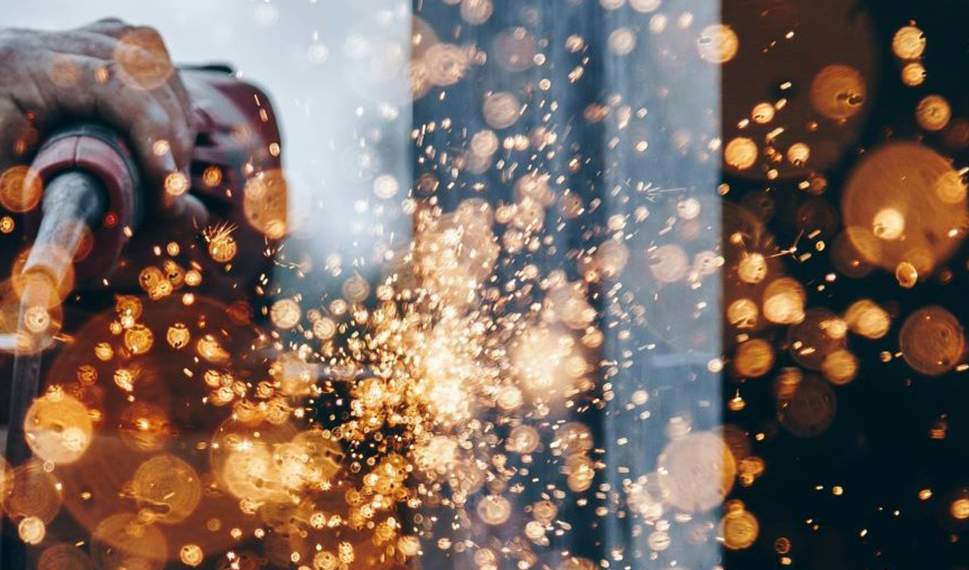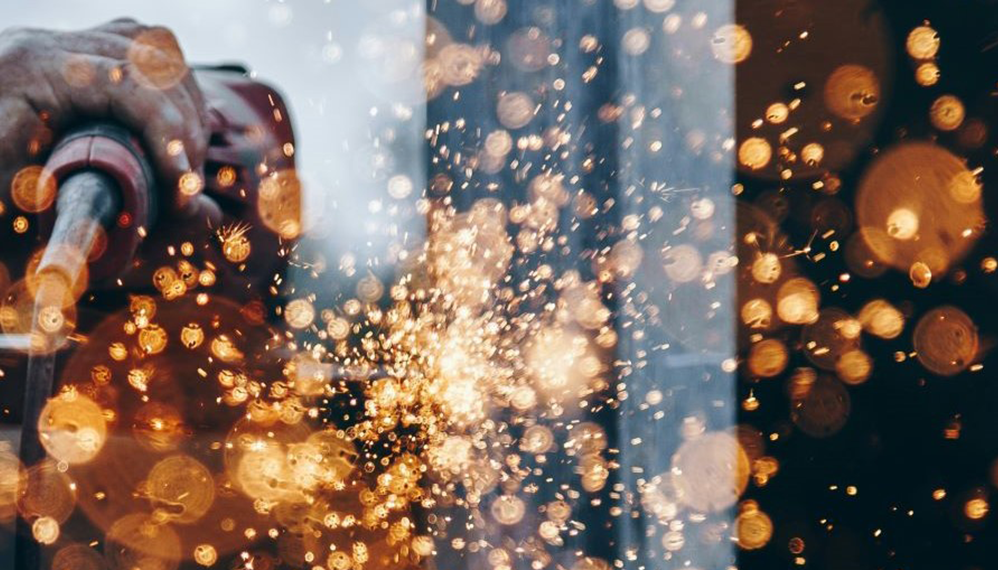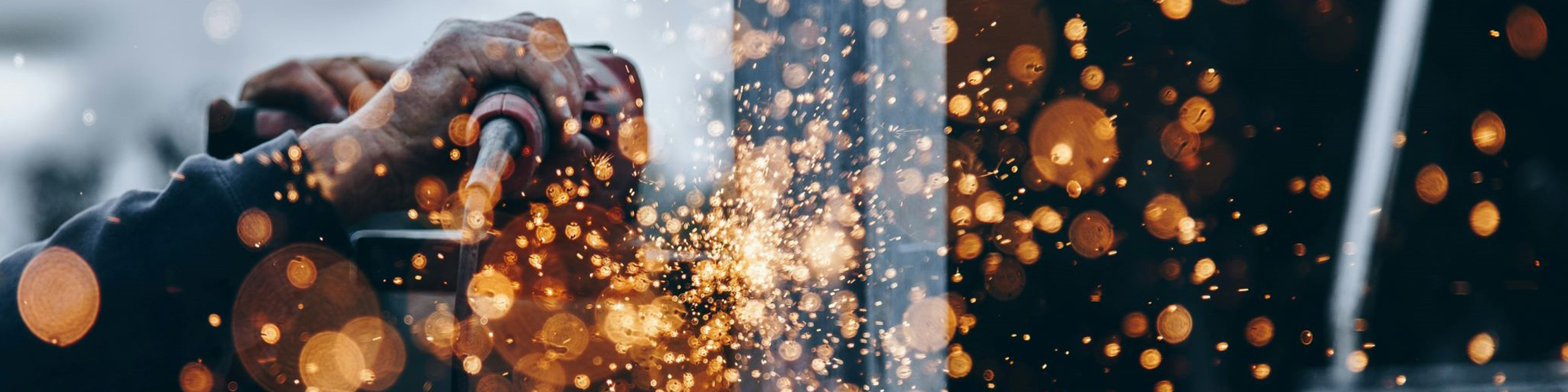Mutig für die Menschenrechte eintreten
Fastenpredigt-Reihe in Buckenhofen/Burk mit Betriebsseelsorger Dr. Manfred Böhm gestartet
Menschenwürdig arbeiten und leben“ – dieses Anliegen aus Lukas 3,10-18 stellte Dr. Manfred Böhm ins Zentrum seiner Predigt. Der Leiter der Betriebsseelsorge im Erzbistum Bamberg eröffnete damit die Fasten-Reihe in Hl. Dreikönig und St. Josef und ermutigte die Zuhörer, sich für menschliche Arbeitsbedingungen stark zu machen.
Anhand eines Drehmomentschlüssels machte Böhm deutlich, dass mit Maschinen sorgfältig umgegangen wird, denn es stehen nicht unerhebliche Werte auf dem Spiel. Der Drehmomentschlüssel stehe für den Schutz der Produktionsanlagen. „Als Betriebsseelsorger, der jahraus und jahrein in den Betrieben unterwegs ist, schaue ich bisweilen ein bisschen neidisch auf dieses Werkzeug“, gestand der Redner, der sich fragte, „warum gibt’s eigentlich für die arbeitenden Menschen nicht auch ein Instrument, das sie vor Überdrehung, vor Überbeanspruchung und vor physischer und psychischer Beschädigung schützt“? Einen Drehmomentschlüssel für die menschliche Würde in der Arbeitswelt sozusagen, geeicht auf die grundsätzliche Aussage aus der Pastoralkonstitution des 2. Vatikanischen Konzils: „Der Mensch ist Urheber, Mittelpunkt und Ziel aller Wirtschaft“. Denn, So Böhm: „Da geht’s doch auch um hohe Werte!“
Auf drei von vielen möglichen Ansatzpunkten eines solchen Drehmomentschlüssels ging der Betriebsseelsorger ein. Als erstes nannte er die Not der Niedriglöhner. Etwa 22 Prozent aller Arbeitnehmer in Deutschland arbeiteten für einen Lohn, der zur Bestreitung ihres Lebensunterhalts nicht mehr ausreicht.
Als Beispiel nannte Böhm eine Beschäftigte in einem Callcenter mit 6,62 Euro Stundenlohn brutto. Manchmal mache sie am Monatsende zwei oder drei Tage krank, weil sie sich die Fahrtkosten zur Arbeit nicht mehr leisten könne. „Aber Aufstockerin will sie nicht werden, das würde sie zu sehr demütigen.“
Von rund 1,4 Millionen Menschen in Deutschland, die Hartz IV beziehen, seien etwa 350 000 vollzeitbeschäftigt. „Nicht einmal mehr eine Vollbeschäftigung kann Menschen vor Verarmung schützen“, macht der Betriebsseelsorger deutlich.
Ein zweiter Ansatzpunkt wäre die Perspektivlosigkeit prekär Beschäftigter, von Menschen in ungesicherten Beschäftigungsverhältnissen. Sie könnten weder ihr Leben noch das ihrer Familien planen. Sie leben arbeitsvertraglich sozusagen von der Hand in den Mund mit befristeten Verträgen oder Werkverträgen, sind Scheinselbständige, Minijobber oder reihen Praktikum an Praktikum. Inzwischen müssten etwa ein Drittel aller Beschäftigten mit sogenannten atypischen Beschäftigungsverhältnissen zurechtkommen. Tendenz weiter steigend.
Und schließlich: Der wachsende Druck am Arbeitsplatz. Immer mehr werde in immer kürzerer Zeit mit immer weniger oder höchstens gleichbleibendem Personal produziert oder geleistet. Dazu käme ein immer flexiblerer Arbeitseinsatz, zunehmend auch an Sonntagen. Auf Dauer machten die hohe Flexibilität und anhaltende Stresssituationen krank. Psychische Belastungen und Burn Out lägen inzwischen an der Spitze der betrieblichen Krankheitsstatistik. Auch wenn es bei vielen Zeitgenossen Skepsis hervorrufe, seien wir beim Thema Arbeit mit der Bibel tatsächlich auf einem guten Weg, denn, so Betriebsseelsorger Böhm: „sie hat tatsächlich mehr zu bieten als fromme Empfehlungen“.
Die prägende Urerfahrung der Hebräer mit ihrem Gott, war die der Befreiung aus den Sklavenarbeitsverhältnissen in Ägypten, die am Anfang der israelitischen Identitätsbildung stand und in der jüdisch-christlichen Tradition bis in die katholische Soziallehre hinein. Die Bibel sei voller Impulse für gute Arbeit. Im heutigen Lukasevangelium werde die Verteilung stark radikalisiert: „Wer zwei Gewänder hat, der gebe eines davon dem, der keines hat, und wer zu essen hat, der handle ebenso“. Und der Betriebsseelsorger machte deutlich: „Was für den einzelnen gilt, gilt auch für die Gesellschaft“.
Die Verteilung des gesellschaftlich erwirtschafteten Reichtums laufe primär über die Entlohnung. Und so widerspreche es der Gerechtigkeit und der Menschenwürde, wenn wir die Niedriglöhner weitgehend davon ausschließen.
Die Katholische Soziallehre nennt die Frage nach dem gerechten Lohn „den Dreh- und Angelpunkt der Sozialethik“, die entscheidende Thematik also. Weil über Geld eben auch Lebenschancen verteilt werden, geht es bei der Lohnfrage immer auch um ein menschenwürdiges Leben in dieser Gesellschaft.
Auch sichere Arbeitsverhältnisse seien grundlegend, da Sicherheit eines der elementarsten menschlichen Bedürfnisse sei. Erst auf der Basis erfüllter Sicherheitsbedürfnisse können wir unser Leben entfalten. Für das gesundheitliche Wohl der einzelnen, für das emotionale Wohl der Familien und für das soziale Wohl der Gesellschaft sind unbefristete und gesicherte Arbeitsverhältnisse unabdingbar.
Schließlich machte der Betriebsseelsorger deutlich, dass gute Arbeit regelmäßige Unterbrechungen braucht. Nicht ohne Grund finde sich in der Bibel das erste und bis heute wirksame Arbeitszeitschutzgesetz der Menschheit: Das Sabbatgebot.
Der hebräische Ausdruck „sabbat“ heißt wörtlich übersetzt nichts anderes als „aufhören“. Und auch im heutigen Evangelium wird dem Zöllner, also jenen, die den Mehrwert abschöpfen, gesagt: „Verlangt nicht mehr als festgesetzt ist“. Also: presst die Menschen nicht aus, nur um eure Profitrate zu erhöhen. Das Innehalten sichere den Vorrang des Menschlichen vor allen wirtschaftlichen Sachzwängen.
Um die Menschenwürde in der Arbeitswelt zu sichern brauche es unsere ständige Wachsamkeit, um die oft schleichenden Veränderungen überhaupt wahrzunehmen. Es brauche einen Maßstab, um diese Veränderungen bewerten zu können. Die Bibel und die Katholische Soziallehre stellen uns dazu brauchbare Werkzeuge zur Verfügung.
Und es braucht nicht zuletzt Zivilcourage, erkannte Fehlentwicklungen in Solidarität mit Gleichgesinnten verändern zu wollen. „Unser Glaube als Christen“, so Böhm „stärkt uns dazu, mutig für Menschenrechte auch in der Arbeitswelt einzutreten.“
Quelle: Heinrichsblatt, Nr. 12, 23. März 2014