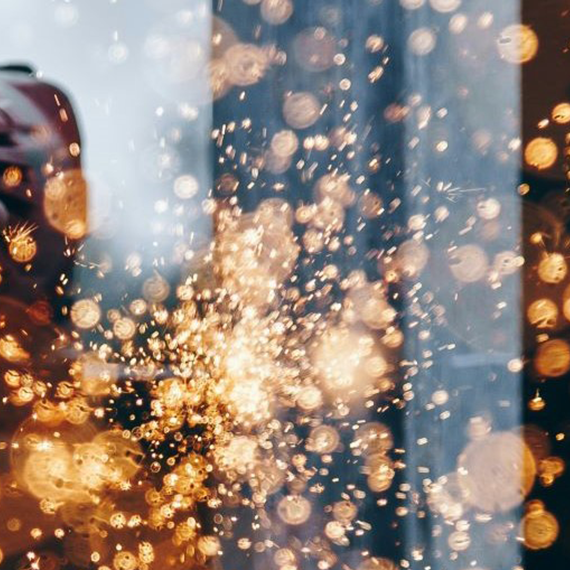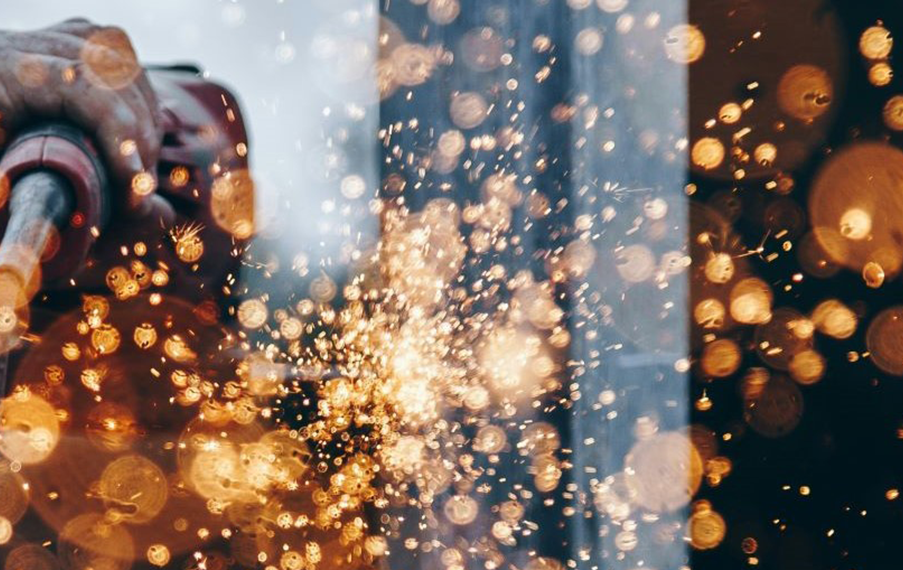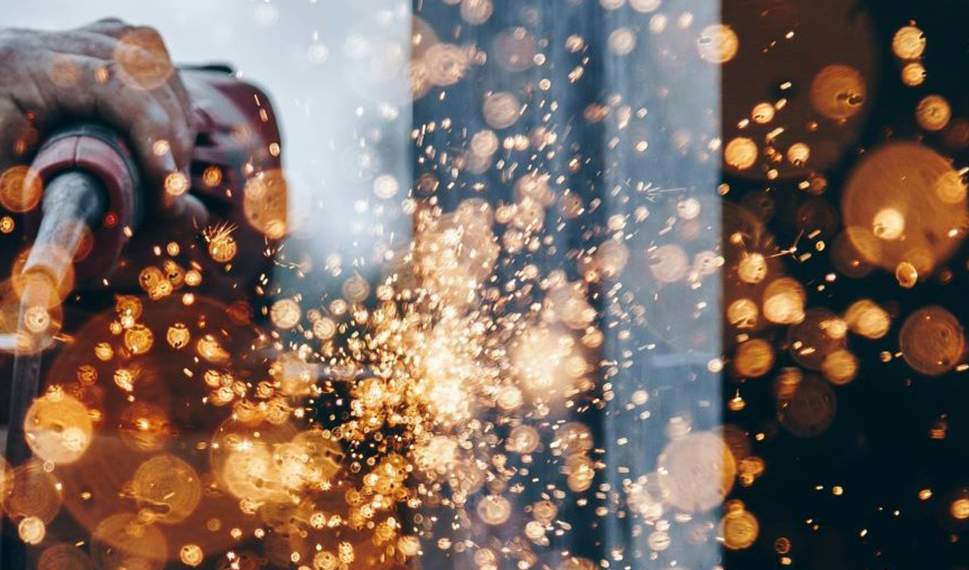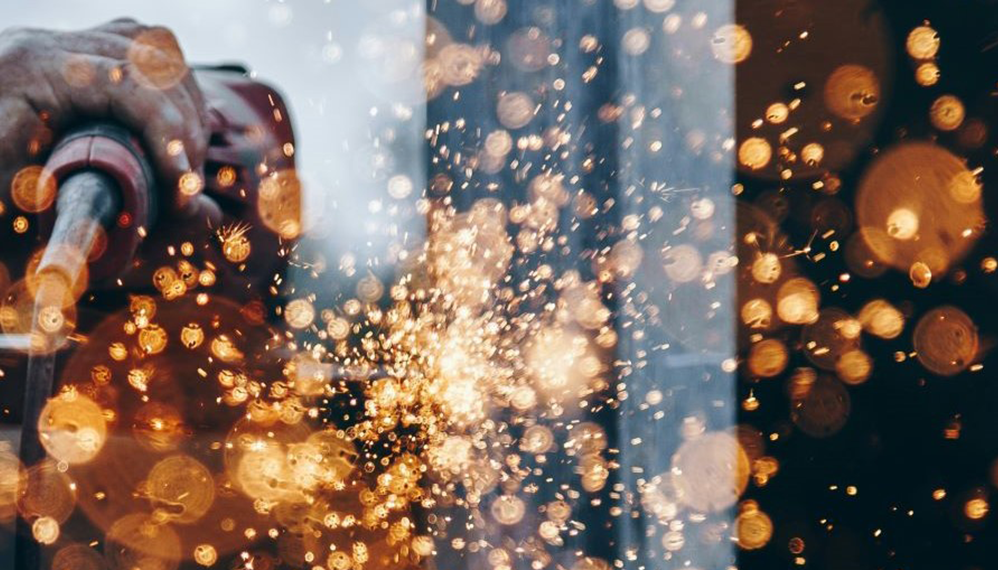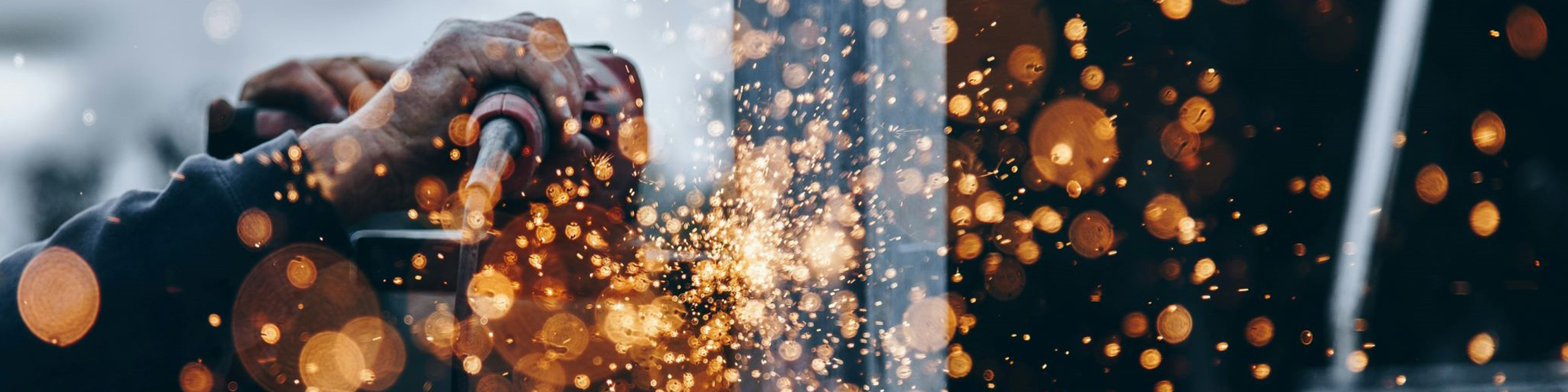Wenn der Gerichtsvollzieher – nicht mehr – klingelt
Zum 1.1.2013 ist von vielen unbemerkt ein neues Gesetz in Kraft getreten, das große Auswirkungen auf Menschen mit Schulden, aber auch andere Bürger, hat.
Zum 1.1.2013 ist von vielen unbemerkt ein neues Gesetz in Kraft getreten, das große Auswirkungen auf Menschen mit Schulden, aber auch andere Bürger, hat.
Aus zahlreichen Fernsehsendungen kennt man die Arbeit des Gerichtsvollziehers, der an der Tür des säumigen Schuldners klingelt und versucht, pfändbare Güter zu finden. Da Haushaltsgegenstände und Güter des täglichen Bedarfs unpfändbar sind, sind diese Versuche oft erfolglos. Und sollten tatsächlich wertvolle Gegenstände, wie z.B. Gemälde, Münzen oder ähnliches gepfändet werden, ist deren Verwertung zeitaufwendig und nicht immer lohnend.
Mit der Neufassung der Zivilprozessordnung ist die Verpflichtung der Gerichtsvollzieher zum persönlichen Vollstreckungsversuch beim Schuldner weggefallen und damit auch die Möglichkeit des Schuldners, im persönlichen Gespräch Lösungen zu suchen. Der Gerichtsvollzieher wird zum Onlinevollstrecker.
Ab 1. Januar 2013 werden alle Daten der Schuldner digital erfasst und in Bayern an das Zentrale Vollstreckungsgericht in Hof weitergeleitet. Dieses übermittelt die Daten an das bundesweite Vollstreckungsportal, welches seinen Sitz in NRW hat.
Der Gerichtsvollzieher hat nunmehr Zugriff auf die Datenbanken anderer Behörden, zum Beispiel auf die der Rentenversicherungsträger, dem Bundesamt für Steuern, das Kraftfahrtbundesamt, die Einwohnermeldeämter sowie die Ausländerbehörden. Der Gerichtsvollzieher kann dadurch im Auftrag des Gläubigers zeitnah den Aufenthaltsort eines Schuldners ermitteln oder Einblick in die Vermögenslage und die Einkommenssituation des Schuldners erhalten, sofern dieser die Angaben verweigert. Zeitaufwendige Recherchen entfallen dadurch. Auch kann der Gläubiger per Mail die Zwangsvollstreckung oder die Lohnpfändung beantragen. Der Gerichtsvollzieher steht nun per Gesetz für die zügige und vollständige Vollstreckung in der Haftung. Die Pflicht zur Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung bleibt nach wie vor bestehen. Diese heißt nun jedoch Vermögensauskunft.
Eine gütliche Einigung soll in jeder Phase des Verfahrens möglich sein, es sei denn, der Gläubiger hat ihr im Zwangsvollstreckungsantrag widersprochen. Jedoch macht eine gütliche Einigung nicht immer Sinn, da sie unter Umständen mit hohen Kosten verbunden ist. Daher sollte zuvor eine Beratung durch eine Schuldnerberatungsstelle erfolgen.
Auch eine Ratenzahlung kann der Gläubiger immer ablehnen. Stimmt er einem Ratenzahlungsplan zu, soll die Tilgung der Schuld innerhalb von 12 Monaten abgeschlossen sein.
Bedenklich im Sinne des Datenschutzes ist die Schaffung des Vollstreckungsportals. Dieses wird zum einen ein Schuldnerverzeichnis und zum anderen ein Vermögensverzeichnisregister enthalten. Auf letzteres haben ausschließlich Gerichtsvollzieher Zugriff. Es wird von Amts wegen nach 2 Jahren nach Abschluss des Verfahrens gelöscht. Eine vorzeitige Löschung ist nicht möglich.
Im Schuldnerverzeichnis werden Informationen wie Insolvenzverfahren oder Zwangs-vollstreckungen gespeichert. Der Schuldner kann hier eine Selbstauskunft beantragen. Allerdings haben auch Dritte mit „berechtigtem Interesse“ Zugang zu den Daten. Wer zu diesen Dritten mit berechtigtem Interesse gehört und wie dieses nachzuweisen ist bleibt abzuwarten. Nach drei Jahren ist hier auf Antrag eine vorzeitige Löschung möglich.