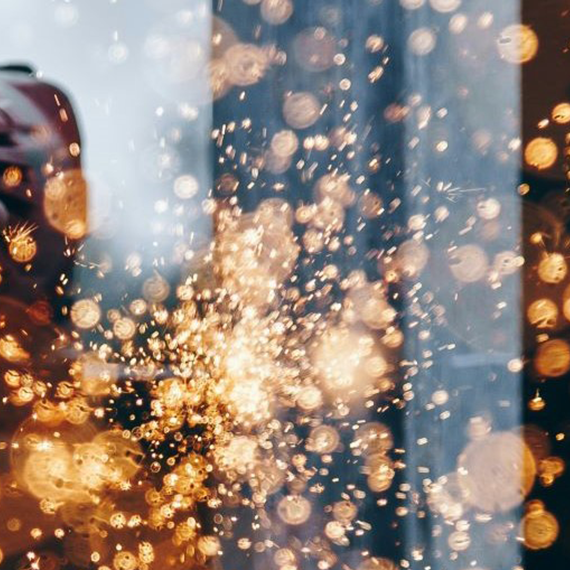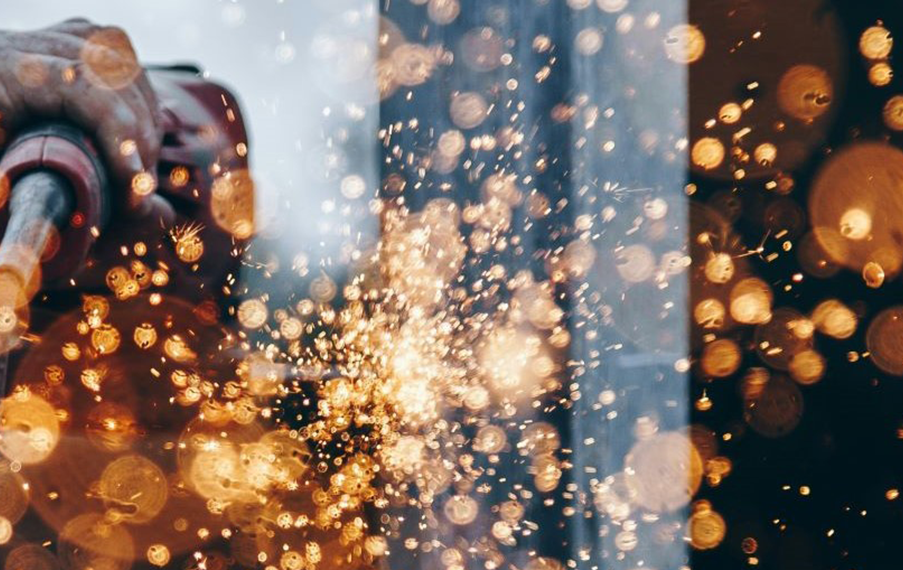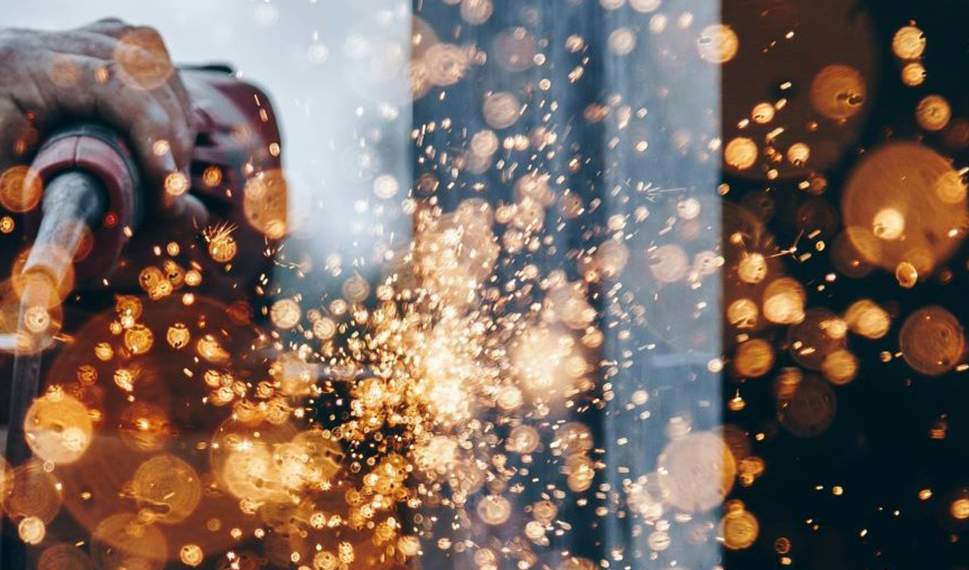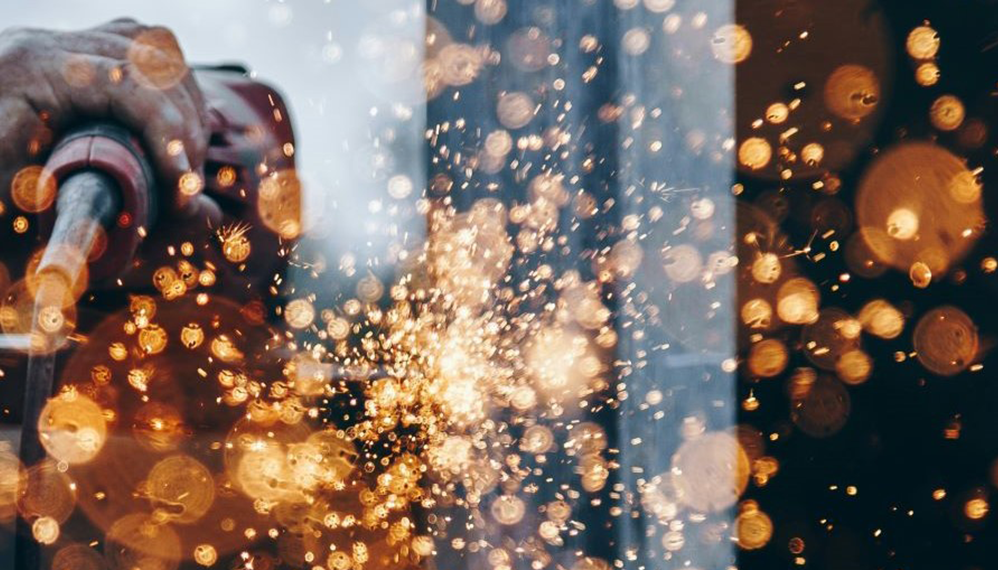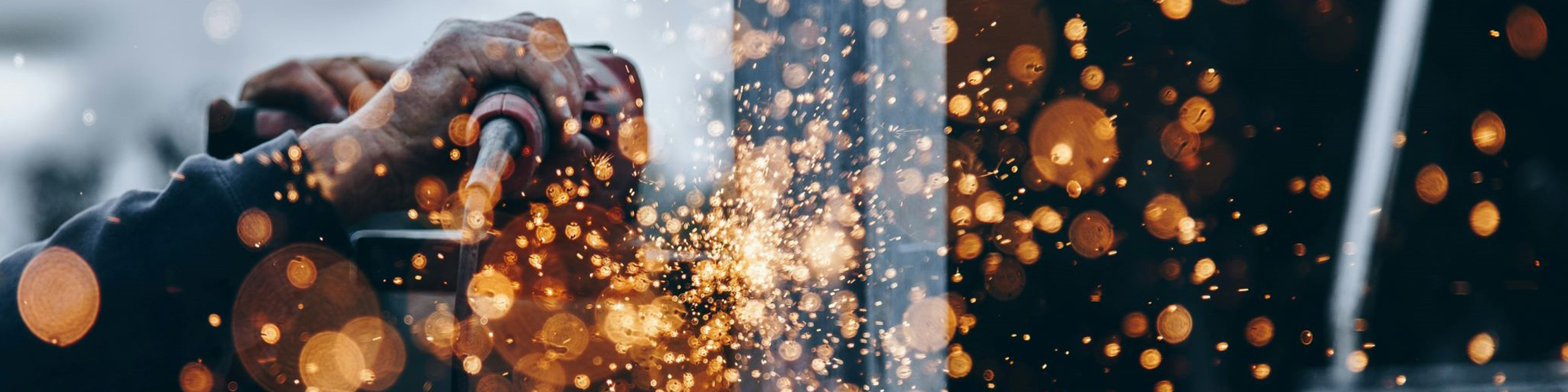"Wer Armen und Schwachen zum Recht verhilft..."

Gotteserkenntnis, so Dr. Manfred Böhm bei einem Vortrag über „Sozialethische Dimensionen des Christlichen Glaubens“ im Herzogenauracher Pfarrzentrum St. Magdalena, setze nicht zwingend ein Theologiestudium, vertiefte Schrift- und Liturgiekenntnisse und Katechismuswissen voraus. Dies belegte der Betriebsseelsorger der Erzbistums Bamberg an einer Bibelstelle aus dem 22. Kapitel des Buches Jeremia, in der es heißt, wer Armen und Schwachen zum Recht verhelfe, kenne Gott wirklich. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Christsein heute“ hatten die Katholische Erwachsenenbildung, die Katholische Arbeitnehmerbewegung, Kolping und der Deutsche Katholische Frauenbund zu dem Vortrag eingeladen.
Böhm folgerte aus der Bibelstelle für sein Thema: „Beim Thema Gerechtigkeit geht es um Gotteserkenntnis, also um das Innerste des Glaubens.“ Wer gemäß der Bibelstelle handele, so Böhm, könne Jeremias Anstoß sofort umsetzen in seinem Verantwortungsbereich, für den er sich zuständig fühle und bei den Menschen, auf die er in seinem Umfeld treffe. Denn sich für arme und an den Rand der Gesellschaft gedrängte Menschen stark zu machen, sei ein zentraler Glaubensinhalt. Dies untermauerte Böhm mit einem Zitat aus dem gemeinsamen Wort der Kirchen „Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit“ aus dem Jahr 1997: „Die Kirchen leben und wirken mitten in der Gesellschaft und nehmen deshalb an ihren Umbrüchen und Entwicklungen teil. Sie werden dabei von Ihrer Berufung zur Solidarität mit den Armen geleitet und Folgen der Bewegung Gottes, der sich vorrangig den Armen, Schwachen und Benachteiligten zugewandt hat, damit alle Leben in Fülle haben.“ Allerdings müsse derjenige, der sich in diesem Sinne – vor allem für eine Umverteilung zugunsten der Benachteiligten - einsetze, so warnte Böhm, in der gegenwärtig vorherrschenden Gesellschaftsströmung des neoliberalistischen Kapitalismus mit Gegenwind rechnen.
Die katholische Soziallehre, so der Referent, sei schon seit jeher von der politischen Mitte abgewichen, indem sie der Arbeit den Vorrang vor dem Kapital einräume und Lohngerechtigkeit zum Dreh- und Angelpunkt mache. So stehe in der Enzyklika Laborem Exercens von Johannes Paul II. aus dem Jahr 1981 geschrieben: „Die gerechte Entlohnung für die Arbeit eines Erwachsenen, der Verantwortung für eine Familie trägt, muss dafür ausreichen, eine Familie zu gründen, angemessen zu unterhalten und ihr Fortkommen zu sichern.“ Arbeit müsse also angemessen bezahlt werden, sodass ein menschenwürdiges Leben davon möglich sei. In Deutschland weite sich derzeit jedoch der Niedriglohnsektor immer weiter aus. Trotz Vollzeitarbeit könnten 400000 Menschen von ihren Einkünften nicht leben und müssten ergänzend Arbeitslosengeld II beziehen. „Das ist ein nicht hinzunehmender Skandal“, empört sich Böhm.
Nach der katholischen Soziallehre seien auch unbefristete, sichere Arbeitsverträge zu befürworten, da Sicherheit eines der fundamentalsten menschlichen Bedürfnisse sei. Ohne diese Sicherheit werde die menschliche Fähigkeit zu Bindung und Solidarität erheblich gestört, da zu viel Energie für die Existenzsicherung aufgewandt werden müsse. „Gesetzt, der Arbeiter beugt sich aus reiner Not oder um einem schlimmeren Zustande zu entgehen, den allzu harten Bedingungen, die ihm nun einmal vom Arbeitsherrn oder Unternehmer auferlegt werden, so heißt das Gewalt leiden, und die Gerechtigkeit erhebt gegen einen solchen Zwang Einspruch“, wies Böhm auf eine Aussage in der schon 1891 entstandenen Enzyklika Rerum Novarum von Papst Leo XIII. hin. Bereits in dieser Enzyklika, die als das Startdatum der katholischen Sozialethik betrachtet werden könne, seien also ungerechte Arbeitsverträge als eine Form der sozialen Gewalt gebrandmarkt worden, da sie den Menschen an seiner freien Entfaltung hinderten.
Auch betriebliche Mitbestimmung gehöre zur Würde des Menschen, denn schließlich seien Unternehmen keine „Maschine zur Erzeugung von Gewinn und Gütern“, sondern zuerst ein Sozialgebilde, in dem Menschen miteinander arbeiteten, betonte Böhm. Wichtig sei es, den Sonntag zu schützen, und hierzu hätten sich gerade in Bayern allerorten Allianzen gebildet. Das biblische Sabbatgebot sei das erste bis heute gültige Arbeitszeitschutzgesetz der Welt und werde in der Bibel damit begründet, dass sich die Menschen gemeinsam an die Befreiung aus der ägyptischen Sklaverei erinnern sollten. Das hebräische Wort Sabbat bedeute „aufhören“, und damit sei gemeint, eine Ruhezeit einzulegen, die für Muse und soziale Kontakte vorbehalten sei, aber nicht für Arbeit und Konsum verzweckt werden solle. „Der Weg in eine pausenlose Gesellschaft ist der Weg in eine gnadenlose Kultur“, wendet sich Böhm gegen die immer stärkere Aufweichung des Sonntags durch Schichtarbeit und verkaufsoffene Zeiten.
Was die Hartz-IV-Gesetzgebung anbelange, so zeige sich darin, dass sich das Menschenbild geändert habe. Wer bis dahin arbeitslos geworden sei, habe Anspruch auf ausgleichende Leistungen gehabt, während man jetzt erst einmal nachweisen müsse, dass man der Hilfe würdig sei, und dazu müsse man sich einer entwürdigenden Prozedur unterziehen. Arbeitslose würden unter den Generalverdacht gestellt, sie wollten den Sozialstaat ausnutzen. „Die strukturelle verfestigte Arbeitslosigkeit lässt sich nicht dadurch mindern, dass das Leid der Betroffenen verstärkt wird“, bezieht Böhm Position. Die katholische Soziallehre gehe hingegen davon aus, dass ausgleichende Verteilung notwendig sei, um Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten. Und der Kirchenvater Augustinus habe dazu gesagt: „Fehlt die Gerechtigkeit, was sind Staaten anderes als große Räuberbanden.“